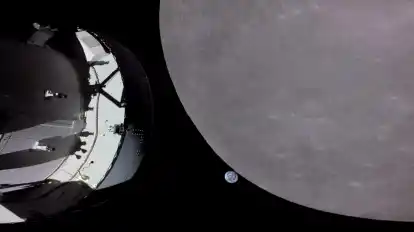Von außen betrachtet, fällt das Gebäude 41 zwischen all den mausgrauen Hallen und Büroblocks auf dem Airbus-Werksgelände am Flughafen kaum auf. Doch hinter der schlichten Fassade beginnt die Reise ins Universum: In einer gleißend hellen und nahezu staubfreien Halle werden seit bald 30 Jahren die Oberstufen der Ariane 5 zusammengebaut – jener Teil der Rakete also, der der Fracht im All den letzten Kick gibt. In der kommenden Woche endet dieses Kapitel Raumfahrtgeschichte: Das Bremer Werk liefert die 117. und letzte Oberstufe für das Ariane-5-Programm aus.
Raumfahrtingenieure neigen im Allgemeinen nicht zum Pathos. Aber wenn die letzte Raketenstufe die Integrationshalle von Gebäude 41 verlässt, "dann geht eine Ära zu Ende", stellt Jens Laßmann fest. Kaum einer kennt das Weltraumvehikel und seine Geschichte so gut wie der langjährige Projektleiter der Oberstufenentwicklung und jetzige Ariane-Standortchef. Beim gescheiterten Erstflug der Ariane 5 im Juni 1996 stand er im Bremer Werk als Praktikant im Publikum und musste auf dem Großbildschirm mit ansehen, wie die Rakete in tausend Teile zerbarst. Keine fünf Jahre später war der junge Raumfahrtingenieur bereits Projektleiter für die neue Oberstufen-Baureihe ESC-A und als solcher dafür mitverantwortlich, ein ähnliches Desaster in Zukunft zu vermeiden. Das gelang zu nahezu hundert Prozent: Die Ariane 5 gilt heute als eine der zuverlässigsten Trägerraketen weltweit.
Mehr als 200 Satelliten, Raumsonden und sonstiges kosmisches Schwergut hat die Bremer Oberstufe ins All befördert. Anders als die Hauptstufe einer Rakete, die mit Motorengebrüll, Pulverdampf und einem langem Feuerschweif an den Start geht, arbeitet die zweite Stufe unsichtbar im Dunkel des Weltalls. Sie zündet erst nach neun Minuten, wenn die erste Stufe ausgebrannt und die Rakete den Blicken der Zuschauer am Boden entschwunden ist. Ihre Aufgabe ist es, der teuren Last den letzten, fein dosierten Anschub zu geben, der sie auf Kurs bringt: Die Raumsonde "Rosetta" schickte sie so auf eine jahrelange Fernreise zum Kometen Tschurjumow-Gerassimenko; dem Planetenspäher "Bepi Colombo" gab sie den nötigen Schwung für seine Erkundungstour zu Venus und Merkur. Den "Weltraumlaster" ATV, der die Internationale Raumstation ISS mit Nachschub versorgte, hievte die Oberstufe gleich serienweise ins Weltall; die Satelliten des europäischen Navigationssystems "Galileo" setzte sie zuletzt im Viererpack aus. Auch das zehn Milliarden Dollar teure US-Weltraumteleskop "James Webb" erreichte vor einem Jahr seinen Beobachtungsposten im All präzise angeschoben von einer Raketenoberstufe made in Bremen.
Dabei hatten die Europäer ursprünglich etwas ganz anderes vor mit ihrer neuen Ariane 5: Als die Mitgliedsländer der Weltraumbehörde Esa 1985 beschlossen, ein größeres Nachfolgemodell für die Ariane 4 zu entwickeln, träumten sie von der bemannten Raumfahrt. Ein Raumgleiter mit dem Namen "Hermes" sollte europäische Astronauten ins All befördern. Und als Starthilfe für den Götterboten war die neue Trägerrakete vorgesehen.
Doch "Hermes" hob nie ab; das Projekt wurde 1992 eingestellt. Und für die fast fertig entwickelte Ariane 5 geriet der Zweitjob zur Hauptaufgabe: der Transport großer, schwerer Satelliten ins Weltall, am besten im Doppelpack, um die Frachtkosten zu senken. Dafür jedoch war die ursprünglich vorgesehene Oberstufe zu klein. "Die Franzosen hatten es den Deutschen zugestanden, die Oberstufe für Ariane 5 selbst zu entwickeln", erinnert sich Laßmann, was angesichts des Führungsanspruchs Frankreichs im Weltall keineswegs selbstverständlich war. "Es sollte ja eigentlich nur ein kleines Teil werden, das dann im Laufe der Entwicklung allerdings immer größer wurde."
Der Erstflug der neuen Rakete am 4. Juni 1996 endete in jenem Desaster, das der junge Praktikant am Großbildschirm erlebte. Kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana geriet die Ariane 5 in Schieflage und sprengte sich selbst in die Luft. "Es war der teuerste Softwarefehler der Geschichte", resümiert Laßmann: Die Steuerung des Navigationssystems, das man vom Vorgängermodell Ariane 4 übernommen hatte, war nicht ausreichend an die größere Rakete angepasst worden – "ein banaler Wir-sparen-ein-bisschen-Geld-Fehler", räumt der Ingenieur ein. Zum Glück war der nicht in Bremen begangen worden.
Auch bei der Entwicklung der größeren Oberstufe ESC-A wollte man Geld sparen und zunächst das bewährte Triebwerk der Ariane 4 übernehmen. Ein neuer Motor war erst für die Version ESC-B vorgesehen, die allerdings nie gebaut wurde. Der Einbau des alten Raketentriebwerks gestaltete sich schwierig: Der Durchmesser der neuen Stufe war doppelt so groß wie der des Vorgängermodells. Ein "Hot Firing Test", also eine Probezündung auf dem Teststand, war nicht vorgesehen. "Wir wurden dann doch etwas nervös", erinnert sich Laßmann und kann wenigstens im Nachhinein darüber lachen. Auf dem Werksgelände bauten sie aus zusammengeschweißten Seecontainern einen improvisierten Teststand, auf dem alle Abläufe beim Anlassen des Triebwerks erprobt wurden – "bis auf die Zündung", versichert Laßmann. Für pyrotechnische Großversuche war das Werksgelände am Bremer Flughafen nicht vorgesehen.
Auch der Erststart der runderneuerten Ariane 5 ECA samt neuer Oberstufe ging schief: Am 11. Dezember 2002 führte ein Triebwerksfehler in der ebenfalls neu entwickelten Hauptstufe zum Absturz der Rakete über Kourou. Die beiden Fehlstarts beim Erstflug 1996 und bei der Premiere der ECA-Version 2002 blieben die einzigen Totalverluste in 26 Jahren Einsatz – an keinem war die Oberstufe aus Bremen schuld. Dazu kommen drei Missionen, bei denen die Rakete zwar abhob, aber nicht den vorgesehenen Orbit erreichte – die Satelliten wurden also an der falschen Stelle ausgesetzt. Einmal war ein Triebwerksschaden der Oberstufe dafür verantwortlich.
"Meistens ist die Ursache menschliches Versagen", sagt Laßmann: ein runtergefallener Schraubenschlüssel, eine nicht fest genug gezogene Mutter, ein loser Stecker, eine falsche Programmierung. Aus wie vielen Teilen eine Oberstufe besteht, weiß nicht einmal der langjährige Projektleiter. Es sind Tausende, und es dauert mehr als ein Jahr, sie in der Integrationshalle von Gebäude 41 zusammenzubauen. Bei jedem Handgriff kann etwas schief gehen. Manches fällt bei Inspektionen und Tests auf, manches nicht. Raketenbau ist immer eine Gratwanderung zwischen Sorgfalt und Kontrolle auf der einen Seite – und der Tatsache, dass das Gerät irgendwann fertig werden muss. Auch in der Raumfahrt nimmt der Konkurrenzdruck zu.
"Aber das Team steht zu 100 Prozent hinter dem Produkt", versichert Laßmann. Manche hätten Tränen in den Augen gehabt, als sie in den vergangenen Tagen zum letzten Mal Hand anlegten an "ihre" Oberstufe. An diesem Freitagnachmittag wollen sie sie mit einer großen Feier und viel lokaler Prominenz verabschieden. Nächste Woche geht es per Schwertransport zum Neustädter Hafen. Noch einmal müssen nachts Straßen gesperrt und die Fahrdrähte der Straßenbahn angehoben werden, damit der sechs Meter hohe Spezialcontainer den Hafen erreicht. Dann geht die letzte Raketenstufe für Ariane 5 auf die Seereise nach Kourou.
Zwei Starts stehen noch aus; der 117. und letzte Flug soll die Raumsonde "Juice" im kommenden Jahr zum Jupiter und seinen Eismonden führen. Doch das Nachfolgemodell ist bereits im Bau: Ariane 6 soll die Arbeit ihrer Vorgängerin fortsetzen, ebenso zuverlässig und dabei noch flexibler und vor allem kostengünstiger. Die Oberstufe der Rakete kommt wieder aus Bremen.