Eine Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie hat für die vergangenen Jahrzehnte mindestens 1259 Beschuldigte dokumentiert. Die am Donnerstag in Hannover vorgestellte Untersuchung unabhängiger Wissenschaftler spricht außerdem von 2225 Betroffenen. Die Zahlen basieren auf Akten der Landeskirchen und der Diakonie, außerdem flossen den Landeskirchen und diakonischen Werken bekannte Fälle ein.
Der Koordinator der Studie geht von einer weit höheren Zahl an Beschuldigten und Betroffenen aus. „Es ist die Spitze der Spitze des Eisberges. Das bitte ich bei der Einordnung der Zahlen und Befunde zu beachten“, sagte Martin Wazlawik von der Hochschule Hannover am Donnerstag bei der Vorstellung der Untersuchung. Nach Hochrechnungen der Wissenschaftler gibt es mehr als 3400 Beschuldigte, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare.
So viele Fälle gibt es in Bremen
Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) hat für die "Forum"-Studie 850 Personalakten nach Hinweisen auf Grenzverletzungen und Disziplinarmaßnahmen untersucht, heißt es in einer Mitteilung der BEK. Die Akten würden "Pfarrpersonen" betreffen, die zwischen 1946 und 2020 im Dienst der BEK standen. Außerdem sei die BEK Zeugenaussagen nachgegangen. Insgesamt gebe es acht Verdächtige, darunter sechs Pastoren.
Wie die BEK mitteilt, waren zwei Disziplinarfälle vom Ende der 1960er und Anfang der 1970er-Jahre bis zur Recherche im Rahmen der Studie noch nicht bekannt. In zwei anderen Verdachtsfällen gebe es keine Person, die direkt zu identifizieren sei oder die bislang nicht ausfindig gemacht werden konnte.
Die BEK erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Fall um Pastor Abramzik, der seit 2010 bekannt ist. Zu diesem Fall seien mit mehr als 25 Personen (Zeitzeugen, Betroffene, Angehörige von Betroffenen) Gespräche geführt worden. Laut BEK waren nach aktuellem Kenntnisstand 14 Personen betroffen.
Die Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), Edda Bosse, begrüßt laut Mitteilung die Veröffentlichung der "Forum"-Studie: "Die 'Forum'-Studie ist ein wichtiger Schritt unseres Engagements gegen sexualisierte Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland, die die Studie angeregt und finanziell gefördert hat." Die BEK betont, dass jedem Anfangsverdacht nachgegangen werde. Die historische Aufarbeitung habe bislang im direkten Kontakt mit den Betroffenen stattgefunden.
Die BEK sucht weiterhin nach weiteren Betroffenen. "Jeder Vorfall", so Edda Bose weiter, "ist einer zu viel und bedeutet für die Betroffenen eine extrem leidvolle Erfahrung. Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt darf es nirgendwo in unserer Kirche geben."
Gesamtbild erschüttert
Die kommissarische EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs sagte, sie habe von der Studie "vieles erwartet, aber das Gesamtbild hat mich doch erschüttert". Die Untersuchung vermittle schwarz auf weiß, "mit welch perfider und brutaler Gewalt Erwachsenen, Jugendlichen und auch Kindern unsägliches Unrecht angetan wurde – mit schweren Verletzungen an Leib und Seele, mit zum Teil lebenslangen Folgen".
In Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen habe es ein Wegsehen gegeben, sagte die Bischöfin. Kirche und Diakonie hätten eklatant versagt und seien Betroffenen nicht gerecht geworden. "Wir haben sie zur Tatzeit nicht geschützt und wir haben sie nicht würdig behandelt, als sie den Mut gefasst haben, sich zu melden." Klar sei: "Wir haben täterschützende Strukturen."

Kirsten Fehrs.
Forscher: Schleppende Zusammenarbeit mit Landeskirchen bei Studie
Bei der Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in der Diakonie ist die Zusammenarbeit mit den Landeskirchen laut einem beteiligten Forscher nur schleppend gelaufen. Von den meisten Landeskirchen seien nicht wie vertraglich vereinbart ausreichend Personalakten zur Verfügung gestellt worden, kritisierte Psychiater Harald Dreßing als Teil der Forschungsgruppe bei der Vorstellung der Studie. Teilweise seien auch "qualitativ unzureichende Daten" übermittelt worden.
"Wir haben keine Wünsche geäußert, sondern wir hatten ein Forschungsdesign, was wir auch von Anfang an klar kommuniziert haben und wozu sich die Evangelische Kirche auch vertraglich verpflichtet hat", sagte Dreßing. Eine systematische Personalakten-Analyse sei ein wesentlicher Teil der Forschungsstrategie gewesen. "Dieses Forschungsvorhaben konnten wir nicht vollständig umsetzen. Das ist nicht unser Versagen, sondern es ist die schleppende Zuarbeit der Landeskirchen gewesen, die in der Tat zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung geführt hat."
Die in der Studie ermittelten Fallzahlen von 2225 Betroffenen basieren auf Akten der Landeskirchen und der Diakonie, außerdem flossen den Landeskirchen und diakonischen Werken bekannte Fälle ein. Die Wissenschaftler konnten aber nicht alle Personalakten aller Pfarrer und Diakone auswerten, sondern in erster Linie Disziplinarakten. Auf Grundlage ihrer Methode kamen die Experten auf eine geschätzte Gesamtzahl von 3497 Beschuldigten.
Dass die Forscher sich nur auf einen Teil der Personalkten, etwa von Pfarrern, in ihrer Analyse beschränkten, sei wegen der Verzögerung "aus der Not heraus geboren", sagte Dreßing. Der Forscher kritisierte die mangelnde Bereitstellung von Akten auch im Vergleich zu einer ähnlichen Studie für die Katholische Kirche, an der er beteiligt war. "Das hat die EKD schlechter hinbekommen, obwohl es im Vorfeld so vereinbart worden war", sagte Dreßing.
Betroffenenvertreter: Evangelische Kirche nicht weniger betroffen als katholische Kirche
Die Betroffenenvertreter forderten Konsequenzen bei der EKD. Katharina Kracht und Detlef Zander würdigten die Bedeutung der Beteiligung von Betroffenen an Aufdeckung und Aufarbeitung von sexueller Gewalt. Nun liege es an der EKD, verbindliche Standards in den Landeskirchen durchzusetzen. Zander betonte, dass durch den Umgang der evangelischen Landeskirchen mit Betroffenen immer noch Menschen retraumatisiert würden. Nun müssten EKD und die Diakonie Verantwortung übernehmen.
"Wer jetzt den Schuss noch nicht gehört hat, der muss sich fragen, ob er am rechten Platz ist", sagte Zander, der als Kind und Jugendlicher in einem evangelischen Heim missbraucht wurde. Der Föderalismus in der Struktur der evangelischen Kirche sei ein "Grundpfeiler für sexuelle Gewalt", betonte der Betroffenensprecher weiter. Dadurch würden Aufklärung und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt verhindert. Man brauche eine übergeordnete Stelle mit Durchgriffsrechten. "Es kann nicht sein, dass jede Landeskirche machen kann, was sie möchte."

Die Ergebnisse der Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche bei ihrer Vorstellung am Donnerstag in Hannover.
Kracht, die als Beirat des Forschungsverbundes mitgewirkt hat, lobte die Einbindung von Betroffenen bei der Erstellung der Studie. Sie hob hervor, dass das Narrativ, die katholische Kirche sei stärker von sexuellem Missbrauch betroffen als die EKD, nicht mehr haltbar sei. Dennoch sei die "Forum"-Studie nicht nur an den Zahlen zu messen, deren Erhebung bereits im Vorfeld kritisch beurteilt worden war. Zahlen und Daten der Kirche seien jedoch nicht wichtiger als die Betroffenen.
Kracht kritisierte, dass zu schnell von Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs die Rede sei. Dabei fehle es an Kompetenz und gegebenenfalls auch Interesse. Die EKD hätte längst Handreichungen erstellen können, um Landeskirchen zu Nachforschungen anzuhalten. "Wenn solche Nachforschungen nicht angestellt werden, bleiben Täter im Dunkeln."
Darüber hinaus bräuchten Betroffene das "Recht auf Aufarbeitung". Es könne nicht sein, dass sie selber die Aufarbeitung in die Hand nehmen müssten. Daher forderte Kracht, die nach eigenen Angaben von einem verheirateten Pfarrer als Jugendliche missbraucht wurde, eine Mitwirkung des Staates und externe Betroffenenbeteiligung.
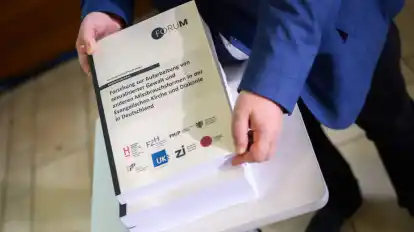
Die Ergebnisse der Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche bei ihrer Vorstellung am Donnerstag in Hannover.




