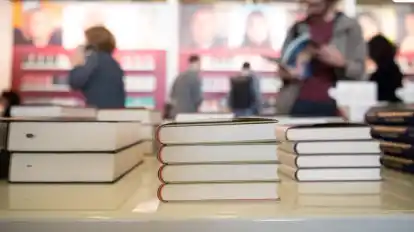Die Frankfurter Buchmesse hatte noch nicht begonnen, da musste sie schon einen Skandal verkraften. Die palästinensische Autorin Adania Shibli wird nun doch nicht mit dem „Liberaturpreis“ ausgezeichnet für ihren Roman „Eine Nebensache“, der teilweise auf historischen Tatsachen beruht, aber, da er Literatur ist, teilweise auch nicht. Der Vorwurf steht im Raum, das Werk bediene antisemitische Klischees. Ob das so ist, darüber wird gestritten.
Derzeit ist die Lage angesichts des Kriegs der Hamas gegen Israel so angespannt, dass eine wie auch immer geartete intellektuelle Debatte über Shiblis Roman der Buchmesse auf jeden Fall schaden würde. Von daher war die Entscheidung genau richtig, ruhigere Tage abzuwarten, um sich mit dem Werk und dem Preis zu befassen.
Auf diese Aufregung im Vorfeld hätte Direktor Jürgen Boos sicher gerne verzichtet, andererseits ist das Thema Kunst- und Meinungsfreiheit eins, das die Buchmesse seit 75 Jahren begleitet. Oder anders gesagt: Von der Debatte, ob Günter Grass' "Blechtrommel" nicht zu blasphemisch für den Deutschen Buchpreis sei (1959) bis zum Streit um die Präsenz rechtslastiger Verlage (2017). Wie lebensgefährlich es sein kann, von seinem Recht zu schreiben, was man will, Gebrauch zu machen, weiß kaum jemand anderer so gut wie Salman Rushdie. Er wird dieses Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Endlich: Seit 33 Jahren lebt Rushdie mit der Todesdrohung des iranischen Mullah-Regimes.
2022 hat er ein Messerattentat überlebt und ist seitdem auf einem Auge blind. Auch das ist ein Aspekt des islamistischen Terrors, wie er sich derzeit im Nahen Osten Bahn bricht, in Frankreich oder Belgien. Die Buchmesse wird betroffen sein, weil die Sicherheitsvorkehrungen für Rushdies Auftritt am Sonntag in der Paulskirche sicherlich das ansonsten übliche Maß übersteigen – für die Stände israelischer Verlage dürfte das sowieso gelten.
Feiern muss man das Jubiläum daher mit einem gewissen Maß an Trotz. Die Messe ist große Bücherschau, Branchentreff, Marktplatz für Autoren und Leseratten. Sie sollte, wo es geht, zu einem rauschenden Fest der freien Meinung werden. In einigen Aspekten steht das sowieso auf dem Programm. Denn die Debatte um Diversität, also um Vielstimmigkeit, nimmt in der Verlagslandschaft immer mehr Raum ein. Gibt es wirklich eine Elite der angeblich alten weißen Verlagsleute, die jungen, queeren, migrantischen Autoren zu wenig Raum gibt? Wer die Verlagskataloge durchblättert, stellt fest: Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Zweite Streitfrage: Muten die angeblich alten weißen Verlagsleute ihren Lesern ganz unsensibel Inhalte zu, die diese nachhaltig psychisch belasten?
Mittlerweile gehören sogenannte Sensitivity Reader in einigen Verlagen zur Belegschaft: Sie sollen Texte auf Stellen abklopfen, die möglicherweise für irgendjemanden anstößig sein könnten. Dann wird dem Autor oder der Autorin geraten, das Manuskript umzuarbeiten. Das kollidiert, man muss es so drastisch sagen, selbstverständlich mit der Kunst- und mit der Meinungsfreiheit. Aber auch mit der Freiheit der Leserschaft, die für unmündig erklärt wird.
Ob einige der erotisch aufgeladenen Szenen und die explizite Sprache, die in den "New-Adult"-Romanen vorkommen, vor den Augen von "Sensitivity Readern" Gnade finden, darf bezweifelt werden. Und doch sind zunehmend junge Leserinnen begeistert und nicht traumatisiert von diesen Schmökern, die einen deutlichen Anteil am Buchhandels-Umsatzplus haben dürften. Auch in der Frankfurter Messe wird "New Adult" breiten Raum einnehmen: Die Liebes- und Selbstfindungsromane haben ihre Stars, auf der Plattform Tiktok wird (Hashtag: Booktok) so munter über das aktuelle Werk von Colleen Hoover diskutiert wie in klassischen Buchclubs über den neuen Daniel Kehlmann. Man sollte sich daher hüten, "New Adult" zu belächeln. Es gibt Fans, die davon schwärmen, bis zu 100 gedruckte (!) Bücher pro Jahr zu lesen. Auch wenn sie irgendwann zu alt werden für Geschichten über die erste Liebe – eine derart entfachte Lese-Leidenschaft bleibt.