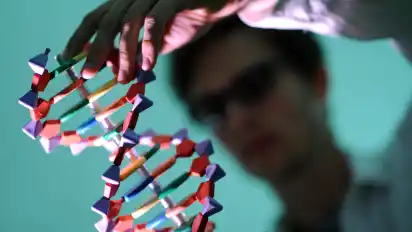Ein Genom ist wie ein Mosaik, das aus der Entfernung ein Gesamtbild ergibt: Viele Teile können durch ähnliche ersetzt werden, ohne das Gesamtbild zu verfälschen. Manche jedoch haben keine Alternative. So formulierte es unlängst der österreichische Genomforscher Siegfried Schloissnig. Vor diesem Hintergrund lässt sich verstehen, weshalb es in der Fachwelt als Meilenstein gilt, dass das Human-Pangenom-Referenzkonsortium am 10. Mai im Fachjournal "Nature" das sogenannte menschliche Pangenom veröffentlicht hat – oder zumindest einen weit fortgeschrittenen Zwischenstand.
Referenzgenom enthielt lange Lücken
Es war eine Sensation, als im Februar 2001 das menschliche Erbgut erstmals als sequenziert galt. Das Humangenomprojekt und die Firma Celera hatten jeweils eine Referenzsequenz vorgelegt, an der im Fall des Humangenomprojekts mehr als tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus rund 40 Ländern seit 1990 gearbeitet hatten. Gut 2,5 Milliarden Euro waren in das Projekt geflossen. Das damals präsentierte Genom war ein Mosaik aus dem Erbgut mehrerer Personen und wies streng genommen noch Lücken auf. Es sollte weitere 20 Jahre dauern, bis diese Lücken als geschlossen gelten konnten.
Dieses Referenzgenom hat bis heute wichtige Funktionen für Medizin und Forschung. Im Prinzip wird ein Erbgut immer in Fragmenten sequenziert, die anschließend anhand von Überlappungen richtig zusammengesetzt werden müssen. Existiert jedoch eine Referenzsequenz, ist diese Arbeit viel einfacher und verlässlicher. Außerdem ermöglicht die Referenz es, die DNA-Sequenz eines Individuums abzugleichen, um Mutationen zu identifizieren, die vielleicht für eine Erkrankung verantwortlich sind.
Pangenom soll menschliche Diversität erfassen
Allerdings kann das bisherige Referenzgenom unmöglich die menschliche Vielfalt abbilden. Zwar teilen alle Menschen den Großteil der rund drei Milliarden Basenpaare der DNA. Doch wie die eingangs beschriebene Analogie des Mosaiks verdeutlicht, gibt es im Detail oft feine Unterschiede – Unterschiede, die über die Haarfarbe oder auch eine tödliche Erbkrankheit entscheiden können.
Das Pangenomprojekt hat das Ziel, die menschliche Vielfalt besser zu erfassen. Dazu will das internationale Team die Genome von 350 möglichst unterschiedlichen Individuen vollständig sequenzieren und gewissermaßen übereinanderlegen. Für jede Stelle des Erbguts wäre ersichtlich, welche Varianten es jeweils gibt und für welche Bevölkerungsgruppen sie typisch sind. Erstmals gelang eine als vollständig betrachtete Sequenzierung eines menschlichen Genoms dank technologischer Fortschritte im vergangenen Jahr. „Vollständig“ bedeutet, dass 99 Prozent der DNA mit 99 Prozent Gewissheit korrekt ausgelesen wurden. Jetzt hat das Pangenomprojekt die Daten von 47 Individuen vorgelegt.
Erkrankungen genetisch diagnostizieren
„Je mehr Genom-Sequenzen in das Referenzgenom eingeschlossen werden, desto genauer wird es, allerdings sind manche Varianten so selten, dass man sie nie vollständig abbilden können wird“, kommentiert Stefan Mundlos, Direktor des Instituts für Medizinische Genetik und Humangenetik an der Berliner Charité. Nichtdestotrotz könne man näher dorthin kommen, dass unterschiedliche Ethnien mit ihrer genomischen Diversität abgebildet werden.
Mundlos sieht im Pangenom großes medizinisches Potenzial: „Für einen erheblichen Anteil der Patienten – etwa ein Drittel –, die eine genetische Krankheit haben, kann man die Krankheit bereits jetzt mit mithilfe des Referenzgenoms diagnostizieren. Allerdings können wir bei etwa zwei Drittel der Patienten, bei denen wir eine genetische Erkrankung vermuten, aber keine Erkrankung diagnostizieren.“ Mit dem vollständigen Genom sollte sich diese Situation verbessern.
Ähnlich sieht es André Reis, Direktor des Humangenetischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen: „Das Pangenom erlaubt vor allem die Untersuchung des Einflusses struktureller Varianten auf Merkmale und Erkrankungen, die bisher nicht in großen genomweiten Assoziationsstudien von sogenannten Volkskrankheiten berücksichtigt werden konnten.“ Die Fachwelt vermute, dass noch wichtige Krankheitsfaktoren in diesen Teilen des Genoms verborgen seien. Außerdem lassen sich jetzt einige Gene analysieren, die aus methodischen Gründen bisher nicht untersuchbar waren. „Wir erwarten daraus auch neue Erkenntnisse zu Zusammenhängen zwischen Genveränderungen und Merkmalen des Menschen, vor allem bei den sogenannten Seltenen Erkrankungen“, sagt Reis.
Präzisionstherapien in der Krebsbehandlung
Fortschritte für die Präzisionsmedizin, also genau auf einzelne Patienten abgestimmte Behandlungen, erhofft sich Peter Lichter, Leiter der Abteilung Molekulare Genetik am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg: „Die Entstehung vieler Krankheiten, insbesondere von Krebs und von klassischen Erbkrankheiten, geht auf Veränderungen im Erbgut zurück. Um die Veränderungen zu erkennen, die für die Entstehung oder Ausbreitung solcher Krankheiten verantwortlich sind, werden die Genome – beispielsweise von Tumorzellen – entschlüsselt und mit dem sogenannten humanen Referenzgenom verglichen.“ Da die meisten Veränderungen keinen Einfluss auf die Zellen haben, also auch medizinisch irrelevant sind, gelte es, die krankheitsrelevanten Veränderungen zu identifizieren.
„Für eine solche Beurteilung ist es hilfreich, als Referenz ein repräsentatives Genom aus einer vergleichbaren menschlichen Population zu verwenden, da in verschiedenen Populationen unterschiedliche genomische Variationen vorherrschen", erklärt Lichter. Langfristig müsse es daher das Ziel sein, weit mehr individuelle Genome vollständig zu entschlüsseln, „um letztendlich eine repräsentative Datenbasis aller genetischen Populationen auf der Erde für eine optimale Selektion des jeweiligen Referenzgenoms zu erhalten“.