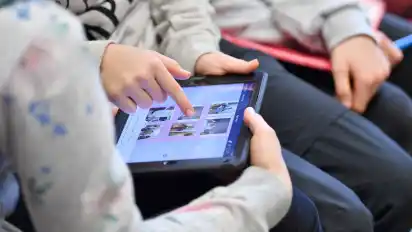Frau Brodnig, durch Ihre Arbeit haben Sie täglich mit Falschmeldungen, Verschwörungsmythen und Hassnachrichten zu tun. Was davon ist Ihnen zuletzt besonders in Erinnerung geblieben?
Ingrid Brodnig: Da ich oft mit schlimmen Behauptungen konfrontiert werde, schockiert mich ehrlicherweise nur noch wenig. Dennoch sind gelegentlich Fälle dabei, die auch ich verstörend finde. Zuletzt war das ein Schwarz-Weiß-Bild, das im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt verbreitet wurde. Darauf waren viele Leichen zu sehen – angeblich ein Massaker, das die Israelis angerichtet hätten. Der Faktencheck zeigte: In Wirklichkeit ist das Foto in einem Konzentrationslager in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Das fand ich besonders grässlich, da der Genozid an Juden genutzt worden ist, um Antisemitismus zu befördern.
Am 9. Juni finden die Europawahlen statt. Für viele ist das Europäische Parlament weit weg, die Wahlbeteiligung ist seit Jahren gering. Was erwarten Sie, in Bezug auf Desinformation und Hatespeech?
Die EU-Wahl weist Gefahren für internationale Propaganda auf, speziell von russischer Seite. Die gesamte EU-Politik ist für einen Player wie Russland besonders wichtig. Russland profitiert davon, wenn Parteien besser abschneiden, die EU-kritisch sind. Wenn die EU gespalten ist, wird es schwieriger, einen härteren Kurs gegen Russland zu fahren, Sanktionen auf den Weg zu bringen oder an ihnen festzuhalten. Zudem wird in Russland von Staatsmedien verbreitet, man selbst sei erfolgreich und die EU zerstritten und ein gescheitertes Projekt.
Unlängst sind Berichte über Manipulationsversuche aus Russland öffentlich geworden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt seit Wochen vor der Beeinflussung durch Desinformation. Werden für solche Angriffe inzwischen gezielt Gruppen eingesetzt?
Es ist berechtigt, alarmiert zu sein. Mittlerweile ist bekannt, dass es in Russland richtige Troll-Fabriken gibt, wo Leute für das Streuen von Fake News bezahlt werden. Im Zuge des Ukraine-Krieges ist im Sommer 2022 eine große Kampagne aufgefallen, bei der gezielt falsche Behauptungen verbreitet wurden. Da hieß es unter anderem, ein jugendlicher Radfahrer wäre in Berlin tödlich verletzt worden, weil nachts die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet wurde, um Energie zu sparen. So wurde Stimmung gegen die Russland-Sanktionen gemacht. Aber die Geschichte war erfunden. Die Seite, die das verbreitet hat, hat zudem so getan, als stamme der Artikel aus der „Bild“-Zeitung. Derartige Beiträge wurden massenweise von unseriösen Accounts in den sozialen Netzwerken geteilt. Das war Teil einer russischen Kampagne, wie sich später herausstellte. So etwas kann auch in den entscheidenden Tagen vor der EU-Wahl passieren.
Beobachten Sie schon jetzt weitere Fälle, in denen gezielt Falschmeldungen gestreut werden?
Es gibt mehrere Meldungen, die seit Monaten immer wieder kursieren. Dazu zählt die Nachricht, Menschen könnten durch Zufall Insekten essen, da die EU eingeführt habe, Insekten dürften ohne Kennzeichnungspflicht in Nahrungsmitteln verarbeitet werden. Das ist zum Beispiel eine Falschmeldung, die bewusst eingesetzt wird, um bei den Menschen Ekel hervorzurufen und eine Abneigung gegen die EU zu erzeugen. Es lässt sich beobachten, wie Meldungen besonders von EU-skeptischen Politikern und Communitys geteilt werden. Schon länger hält sich auch das Gerücht, die EU würde verbieten, ältere Autos reparieren zu lassen, was einfach nicht stimmt. Dadurch soll ein Bild von Brüssel als unnötiges Bürokratiemonster entstehen.
Sind Themen wie die Europawahl anfälliger für Verschwörungsmythen und Fake News, weil das Wissen über die EU sowieso nicht so groß ist?
Wenig Wissen erleichtert zumindest, ein Schreckgespenst aufzubauen. Weil Brüssel so fern wirkt, lassen sich Grusel-Geschichten wie mit den Insekten oder dem Auto einfacher verbreiten. Gleichzeitig ist die EU-Wahl für viele ein abstrakteres Thema als eine nationale Wahl. Sie geht Menschen nicht so sehr ans Herz. Deshalb müssen Falschmeldungen zur EU starke Emotionen aktivieren, wie Angst oder Ekel, oder versuchen, Feindbilder zu erzeugen. Führungspersonen der EU wie Ursula von der Leyen werden von einigen Seiten gezielt als Feindbild aufgebaut.
Welche Rolle spielen dabei soziale Medien oder Messengerdienste wie Telegram?
EU-Skeptiker gab es auch schon vor dem Einsatz sozialer Medien. Allerdings können sie sich nun leichter miteinander vernetzen. Die größten Fans der Europäischen Union und die größten Gegner können so stärker in Erscheinung treten und schneller Informationen teilen. Social Media führt zu einer stärkeren Sichtbarkeit von jenen mit starker Meinung. Gefährlich ist momentan die Entwicklung der Plattform X, ehemals Twitter, die für politische Debatten besonders relevant ist.
Inwiefern?
Die Kontrolle und Moderation auf der Plattform ist oft miserabel. X hat einen Großteil des Personals entlassen und die Regeln gelockert. Unseriöse Kanäle können Falschmeldungen verbreiten. Darüber hinaus gibt es ein riesiges Problem mit Spam-Bots, die massenweise Kommentare und Meldungen erzeugen. Elon Musk hatte angekündigt, dagegen vorgehen zu wollen, doch es ist eher schlimmer geworden, was auch Desinformation begünstigt. Zudem kann sich inzwischen jeder den sogenannten blauen Haken kaufen, durch den man früher erkennen konnte, ob eine Person verifiziert ist, und beispielsweise wusste man, dass es sich um einen echten Auslandskorrespondenten handelt. Das fällt nun weg. Wir konnten im Nahostkonflikt beobachten, wie sich dadurch Falschmeldungen leichter verbreiten.
Was raten Sie den Leuten, um sich vor solchen Meldungen zu schützen oder sie zu erkennen?
Es hilft immer, auf die eigene Emotionalität zu achten. Wie reagiere ich auf einen Beitrag? Manche Dinge im politischen Diskurs, die Wut auslösen, sind real, keine Frage, aber manchmal sind gerade Falschmeldungen bewusst so formuliert, dass man als Leser wütend wird auf „die da oben“. Das erkennt man nicht immer gleich und teilt es schnell mal mit der Familie oder den Freunden. Helfen kann da eine gewisse Medienkompetenz. Es empfiehlt sich immer, genau nach der Quelle zu schauen. Handelt es sich um einen anonymen Kanal, ist das ein Alarmzeichen. Wenn ich mir bei Fotos unsicher bin, kann ich per Suchmaschine die Bildquelle recherchieren und sehe womöglich, dass das Bild bearbeitet wurde oder schon alt ist.
Gibt es bestimmte Personengruppen, die eher dazu neigen, Verschwörungsmythen zu glauben?
Tatsächlich haben höher gebildete Menschen eine etwas geringere Chance, solche Narrative für wahr zu halten. Nichtsdestotrotz ist Bildung kein absoluter Schutzschild, das haben wir gerade während der Corona-Pandemie gesehen. Sogar Ärzte und Professoren haben nachweisbar Falsches verbreitet und geglaubt.
Geben Verschwörungsmythen in unsicheren Zeiten auch Halt?
Aktuell sind wir auf der Welt mit mehreren Themen konfrontiert, die beängstigend sein können: Kriege, die Klimakrise. In herausfordernden Zeiten wächst bei einigen die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen, die Verschwörungsmythen liefern können. Sie identifizieren einen Sündenbock. Oder aber sie bedienen das Bedürfnis nach Einzigartigkeit, dass ich etwas verstanden habe, was die anderen nicht durchblicken. Was es zusätzlich sehr schwer macht, diese Menschen zu erreichen, ist ihr Umfeld. Wer einmal sehr tief drinsteckt, bewegt sich meist in einer Szene, die ähnlich denkt und sich auf ähnlichen Kanälen informiert.
Sie haben die Pandemie schon angesprochen. Während dieser Zeit sahen sich viele Menschen mit Verschwörungstheorien und Falschmeldungen konfrontiert- mitunter sogar in der eigenen Familie und im Freundeskreis. Wie diskutiert man mit solchen Leuten?
Bei Personen, die tief in der Verschwörungsszene drinstecken, werden Sie mit einem schnellen Hinweis auf die Fakten vermutlich wenig bewirken. Aber auch Menschen, die eigentlich nicht so leicht empfänglich für derartige Geschichten sind, fallen gelegentlich auf so etwas rein. Längst nicht alle Personen, die eine Falschmeldung teilen, sind vollends überzeugt davon. Deshalb lohnt es sich in vielen Fällen, sachlich und respektvoll auf die Falschmeldung hinzuweisen.
Und was, wenn jemand schon sehr tief in eine gewisse Szene reingeraten ist?
In solchen Fällen empfehle ich, ab und zu die Einladung zu geben, das eigene Denken zu hinterfragen. Oft wollen wir solche Personen direkt mit Fakten konfrontieren und merken, es prallt an den Betroffenen ab. Man könnte stattdessen eher auf die Frageebene ausweichen und sich erkundigen, warum derjenige das glaubt und warum er gerade dieser Quelle traut. Wenn man das respektvoll macht und das Gegenüber noch einigermaßen offen für den Diskurs ist, kann das Menschen wieder zum Zweifeln bringen. Es gibt die Chance, dass Menschen manchmal umdenken. Aber diese Einsicht kann die Person nur selbst entwickeln. Man kennt das von sich selbst, man will keine Meinung aufgezwungen bekommen. Es kann auch helfen, an der Atmosphäre zu arbeiten.
Wie meinen Sie das?
Es kommt manchmal darauf an, wie ich etwas vermittle. Für Menschen fühlt es sich schnell so an, als würde man ihre gesamte Persönlichkeit oder ihre Intelligenz angreifen, wenn man ihnen in einer Sachfrage widerspricht. Wenn man jedoch zuerst vermittelt, wie sehr man die Meinung und Person schätzt und dann erst in der Sache argumentiert, macht man es seinem Gegenüber leichter, sich einen Fehler einzugestehen. Poltert man hingegen direkt drauflos, stößt man die Person vor den Kopf und derjenige fürchtet vielleicht einen Gesichtsverlust. Das macht es schwieriger, jemanden zu erreichen.