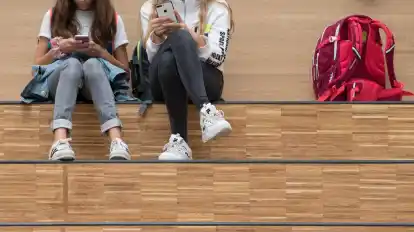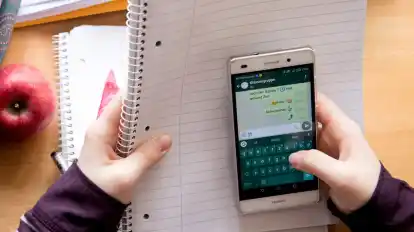Erinnert sich noch jemand an die hitzigen Diskussionen, die es gab, als in den 1970er-Jahren die Gurtpflicht beim Autofahren eingeführt werden sollte, an den Beginn der Mülltrennung in den 90ern oder an das Rauchverbot in Gaststätten in den 2000er-Jahren? Jedes Mal wurde diskutiert, als ginge es um alles.
Jetzt guckt der Staat den Bürgern schon in die Mülltonne, hieß es, als die Gelben Säcke kamen. Noch nie seien sie dermaßen diskriminiert worden, sagten Raucher, die sich fortan nur noch in separaten Räumen oder draußen vor der Tür eine anstecken durften. Ab sofort endet jeder Auffahrunfall mit gequetschten Brustkörben und abgetrennten Gliedmaßen, sagten die Gegner der Anschnallpflicht, weil sich die Gurte wie Filetiermesser durchs Fleisch schneiden würden. Ganz schön viel Wind wurde damals gemacht.
Der Dauerbrenner dieses Jahrzehnts sind Handys an Schulen. Aktuell befeuern die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg die Diskussion wieder, weil sie die private Nutzung während der Schulzeit verbieten wollen. Bremen hat das Thema nach einem Vorstoß der CDU Anfang des Jahres zu den Akten gelegt. Eine Begründung: Es bestehe kein Handlungsbedarf, da inzwischen jede Schule eine Regelung getroffen habe. Haken dran also?
Nein. Denn erstens macht es sich die Politik sehr leicht, indem sie die Entscheidung den Schulen überlässt. So verscherzt man es sich nicht mit den Gegnern eines Handyverbots, mit Interessensverbänden zum Beispiel oder Teilen der Eltern- und Schülerschaft.
Zweitens gibt es einen Wildwuchs bei den Regeln, wenn jede Schule für sich selbst bestimmt, wie es mit dem Handygebrauch am besten ist. Handymitnahme ja, aber nur für die mittleren und älteren Jahrgänge. Oder doch für alle? Dann aber mit angepassten Regeln zur Benutzung. Also nicht auf dem Schulhof. Aber im Jahrgangsstufenflur schon. Und in den Pausen. Oder nur in den großen Pausen? Handyaufbewahrung in der Hosentasche? Umgedreht auf dem Tisch? Oder besser tief unten im Rucksack? Mal so, mal so, mal anders, mal ganz anders.
Das mag spitzfindig klingen, ist es aber nicht. Es macht nämlich einen riesigen Unterschied, ob Handys zu Hause liegen, aus den Augen, aus dem Sinn, oder ob man sie griffbereit hat. Der Gedanke, etwas verpassen zu können, erzeugt Stress. Da hilft es auch nichts, das Handy auf stumm oder abzuschalten. Es bleibt präsent. Kein trockener Alkoholiker, der es bleiben möchte, käme auf die Idee, sich Tag für Tag einen Flachmann in die Hosentasche zu stecken.
Es gibt inzwischen mehrere Studien, die belegen, dass Handyverbote in Schulen das soziale Klima verbessern und Lernleistungen steigern. Die Schüler reden in den Pausen miteinander. Sie schauen sich an, gehen auf den Schulhof. Sie können sich in den Stunden besser konzentrieren.
Gegner eines Handyverbots tun so, als würde damit die Abkehr von der Digitalisierung des Unterrichts eingeläutet, ein Rückfall in die analoge Steinzeit mit Tafel und Kreide sozusagen. Aber das stimmt ja nicht. Bremen und alle anderen Bundesländer sind stolz darauf, inzwischen Hunderttausende von Schülern mit Tablets ausgestattet zu haben. Mit ihnen und den entsprechenden Sicherheitseinstellungen ist effektiver digitaler Unterricht weiterhin möglich, ja sogar nötig. Denn der richtige Umgang mit digitalen Medien muss ein zentrales pädagogisches Ziel von Schule sein.
Vielleicht muss man sich auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass die Erfindung von Handys keine Mildtätigkeit der Industrie, sondern getrieben ist von handfesten Interessen. Es ist das Ziel der Tech-Konzerne, Menschen so lange wie möglich an ihr Handy zu fesseln. Sei es, um Daten abzugreifen, Verhaltensmuster zu entschlüsseln, Produkte zu verkaufen oder Stimmungen zu beeinflussen.
Sechs bis maximal acht Stunden am Tag offline zu sein, ist keine Zumutung. Es wäre im Gegenteil ein Gewinn, wenn ein Handyverbot an Schulen irgendwann genauso selbstverständlich wäre wie die Anschnallpflicht, die Mülltrennung und rauchfreie Zonen.