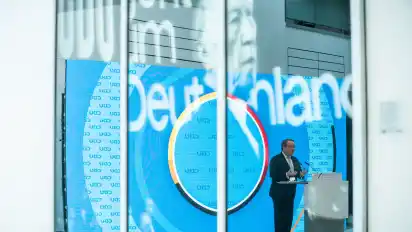Frau Roßbach, einmal mehr wird über die Rente mit 68, ja sogar mit 70 diskutiert. Wie bewerten Sie diese Debatte?
Gundula Roßbach: Das Eintrittsalter ist nur eine der Stellschrauben, wenn es um die Frage geht, wie die Rente zukunftsfest gemacht werden kann. Es bringt wenig, das isoliert zu betrachten. Wir sind jetzt noch bis 2031 in der Umsetzung der Rente mit 67. Die Zahlen zeigen, dass die Menschen im Durchschnitt mit rund 64 in Rente gehen. Wir sollten uns gerade bei dieser Entscheidung die notwendige Zeit nehmen und vermeiden, dass sie wegen veränderter Rahmenbedingungen später wieder korrigiert werden muss. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise und ihrer möglichen Folgewirkungen.
Mit der Forderung nach einem höheren Renteneintrittsalter ist immer auch die Kritik verbunden, die gesetzliche Rente sei sonst nicht zukunftsfest. So sagt der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayer: „Wenn die Politik das Rentensystem nicht reformiert, werden die Lasten für den Haushalt massiv ansteigen. Wenn die Politik hingegen so tut, als sei zwei und zwei fünf, belügt sie sich selbst und auch die Wähler“. Was halten Sie von solchen Aussagen?
Berechnungen bis zum Jahr 2045 zeigen: Wir sind weit entfernt von irgendwelchen Schreckensszenarien. Uns ist es in den letzten zwanzig Jahren gelungen, die Rentenversicherung sehr gut auszutarieren. Natürlich müssen wir uns gesamtgesellschaftlich überlegen, wie wir mit einem höheren Anteil Älterer umgehen wollen. Und was wir bereit sind, dafür auch zu investieren. Von Panikmache halte ich aber gar nichts.
Sie haben es gerade gesagt: Bisher ist noch nicht einmal die schrittweise Anhebung auf 67 Jahre umgesetzt worden. Im Durchschnitt gehen die Menschen mit 64 Jahren in Rente. Ist also nicht eher der Trend ungebrochen, vorzeitig in Rente zu gehen – trotz der Abschläge?
Ja, wir haben nach wie vor eine deutliche Inanspruchnahme der vorgezogenen Altersrenten. Der Run auf die Rente ab 63 hält an, sonst wären wir eben nicht beim Durchschnittsalter 64, sondern darüber. Auffällig ist aber auch, dass immer mehr Menschen länger arbeiten, als sie wegen der Altersgrenze müssten – wenn auch häufig nicht in Vollzeit.
Eine vorgezogene Rente muss man sich zum einen leisten können. Zum anderen ist es für Menschen, die in körperlich schweren Berufen arbeiten, oft schon nicht möglich, bis 65 zu arbeiten. Das bedeutet schmerzhafte Rentenkürzungen. Müsste das nicht sozial abgefedert werden?
Um dies zu erreichen, haben wir ja bereits bei der Erwerbsminderungsrente deutlich nachjustiert, was auch nötig war. Damit können diese Renten durchaus höher sein als eine vorzeitige Altersrente. Und die aktuellen Zahlen zu den Anträgen zeigen: Diese Rentenform ist deutlich attraktiver geworden. Andererseits rechtfertigt nicht jede gesundheitliche Beeinträchtigung eine Erwerbsminderung. Da müssen wir schon sehr genau hinschauen, auch wenn das nicht immer auf Verständnis trifft.
Später in Rente zu gehen, ist eine der Stellschrauben, um die Rentenversicherung finanziell zu entlasten. Eine weitere Idee wäre es, den Kreis der Beitragszahler zu erweitern. Hat Sie der Vorstoß einiger Bundestagsabgeordneter überrascht, die vorschlagen, den steuerfinanzierten Sonderstatus ihrer Altersversorgung aufzugeben und in die Rentenkasse einzuzahlen?
Diese Diskussion ist ja gar nicht so neu. Und die Altersversorgung von Parlamentariern in den Bundesländern wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber ich halte es schon für richtig, dass sich Politiker immer wieder die Frage stellen, ob sie nicht Bestandteil des gesetzlichen Rentensystems sein sollten. Natürlich sind etwas über 700 Bundestagsabgeordnete jetzt nicht der entscheidende Faktor für eine Be- oder Entlastung der Rentenversicherung.
Viel helfen würde das der Rentenversicherung in der Tat nicht - es wäre eher ein symbolischer Wert. Über 50 Millionen Euro kosten die Abgeordnetenpensionen aktuell den Bund. Zum Vergleich: Die Beamtenpensionen kosten dem Staat inklusive Beihilfezahlungen für Krankenbehandlungen über 65 Milliarden Euro. Wäre die gesetzliche Rentenversicherung also saniert, wenn zukünftig nicht nur Politiker, sondern auch Beamte, alle Selbstständigen und Freiberufler in die Rentenkasse einzahlen müssten?
Meiner Meinung nach muss in unserer Gesellschaft einfach geklärt werden, wer in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. In Österreich ist entschieden worden, die Beamten mit einzubeziehen, allerdings mit einer 40-jährigen Übergangsfrist. Von heute auf morgen ist das nicht umzusetzen. Klar ist aber auch: Eine Einbeziehung brächte zwar kurzfristig zusätzliche Beitragseinnahmen für die Rentenversicherung, auf mittlere und längere Sicht aber auch deutlich höhere Ausgaben.
Sie reden vom Aspekt der sozialen Gleichbehandlung?
Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang insbesondere die Altersvorsorge bei den Selbstständigen. Wir sind in Europa mit das einzige Land, das ihnen keine obligatorische Alterssicherung anbietet. Genau die Selbstständigen aber haben das höchste Risiko, im Alter in der Grundsicherung zu landen. Ich denke, darüber sollten wir diskutieren. Für mich wäre das ein wichtiges Ziel für die nächste Legislaturperiode.
Neben der Sonderstellung von Beamten wird es immer wieder als ungerecht empfunden, dass aus der Rentenkasse zu viele Fremdleistungen bezahlt würden. Ist dieser Vorwurf berechtigt?
Ja, darüber wird viel debattiert, die Rentenversicherung ist eben auch eine Sozialversicherung mit Umverteilungselementen. Aber natürlich ist die Frage der Finanzierung zu klären. Wir erhalten den Bundeszuschuss – und damit haben wir den Steuerzahler als Mitfinancier für die Kosten der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die die Rentenversicherung übernimmt und für die sie keine Beiträge erhält. Ob der Bundeszuschuss immer ausreicht, gerade bei Leistungen, die klar steuerfinanziert sein müssten, ist eine ganz andere Frage.
Die Mütterrente ist ein solcher Fall.
Zum Beispiel. Aber auch einige Folgelasten durch die deutsche Einheit. Und da muss der Staat auch mitfinanzieren, weil er es war, der entschieden hat, dass diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben von der Rentenversicherung getragen werden sollen, ohne dass ihnen vielfach entsprechende Beiträge gegenüberstehen. Und es ist sicher noch Luft nach oben, was die Höhe der Bundeszuschüsse angeht.
Der Staat dürfte sich also gerne noch spendabler zeigen?
Ich würde nicht von spendabel sprechen. Der Bund sollte das finanzieren, was die Rentenversicherung als nicht beitragsgedeckte Leistungen zahlt.
Sprechen wir über die ab 1. Januar wirksame Grundrente. Obwohl der Name so klingt, ist sie keine eigenständige neue Rente, sondern nur ein Zuschlag auf bestehende Renten. Wie läuft die Umsetzung?
Die Grundrente zu berechnen, ist eine aufwendige und hochkomplexe Arbeit. Aber wir sind mit Hochdruck dabei und ich kann sagen: Im Laufe der Woche kommen die ersten Rentenbescheide.
Bestätigt sich der im Vorfeld von Arbeitsministerium ermittelte durchschnittliche Zahlbetrag in Höhe von 75 Euro?
Das sind bisher noch Prognosen. Genauere Aussagen sind hier erst möglich, wenn eine repräsentative Zahl von Grundrentenzuschlägen tatsächlich berechnet worden ist. Ich bin selber auf die Zahlen sehr gespannt.
Rechtfertigt dieser im Mittel doch sehr bescheidene Betrag wirklich den enormen Verwaltungsaufwand? Immerhin musste die Deutsche Rentenversicherung Bund zusätzlich zum Start über 1000 Vollzeitkräfte zusätzlich einstellen.
Das ist für uns keine Frage. Wir als Rentenversicherung haben die gesetzlichen Vorgaben umzusetzen. Und wir sind nach dem Beschluss des Bundestages auch mit vollem Elan ans Werk gegangen.
Dennoch ist nicht verborgen geblieben, dass die Rentenversicherung sich lange gegen dieses bürokratische Monstrum Grundrente gewehrt hat. Stimmt es, dass der Bund sie allein in diesem Jahr auf zusätzliche Verwaltungskosten in Höhe von 410 Millionen Euro sitzen lässt?
Es gibt für die zusätzlichen Verwaltungskosten keine Extra-Erstattung.
Ärgert Sie das?
Unsere Selbstverwaltung und auch ich selber hätten es sich anders gewünscht und dies haben wir auch eingefordert.
Eine Frage zum alles beherrschenden Thema Covid: Inzwischen leiden in Deutschland etwa 350.000 Menschen an Long-Covid, also an Langzeitfolgen der Virusinfektion. Es muss befürchtet werden, dass die Zahlen weiter steigen. Was bedeutet das für die Rentenversicherung, die ja auch für Rehabilitationsleistungen zuständig ist?
Wir haben es zum einen mit Fällen zu tun, die eine Reha nach einer schweren Covid-Erkrankung beantragen, also Menschen, die zum Beispiel lange auf einer Intensivstation waren. Und zum anderen eben auch zunehmend mit Menschen, die an Langzeitfolgen nach ihrer Infektion leiden – zum Beispiel unter Erschöpfungssymptomen. Unsere Erhebungen zeigen, dass die Post-Covid-Reha sehr erfolgreich ist.
Das Wichtigste zum Schluss, Frau Roßbach: Wie entwickelt sich der Beitragssatz, und wie hoch wird die Rentenanpassung im nächsten Jahr ausfallen?
Nach der letzten Schätzung im Juni wird der Beitragssatz im nächsten und übernächsten Jahr stabil bei 18,6 Prozent bleiben. Im Jahr 2024 wird er dann ansteigen. Er wird aber auch 2025 voraussichtlich noch unter 20 Prozent liegen.
Das heißt, ab 2025 rechnen Sie mit einem deutlichen Anstieg des Beitragssatzes?
Die demografische Entwicklung beginnt zu wirken, aber für zuverlässige Zahlen ist es noch viel zu früh.
Und die Rentenanpassung?
Wie immer lassen sich zuverlässige Zahlen erst im Frühjahr des nächsten Jahres nennen, aber wir erwarten in 2022 eine hohe Rentenanpassung.
Eine Erhöhung um 4,8 Prozent im Westen und um 5,6 Prozent im Osten steht im Raum?
Diese Zahlen kommentiere ich nicht, schon gar nicht in einem Wahljahr.
Das Interview führte Hans-Ulrich Brandt