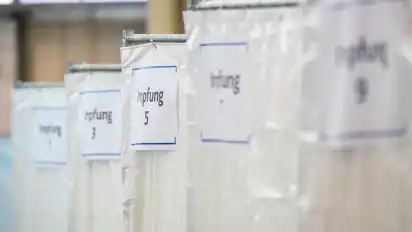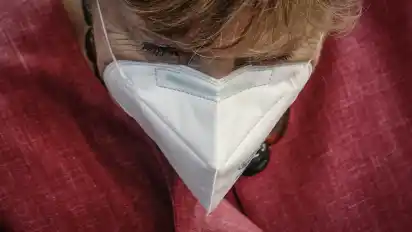Was lange versäumt wurde, müssen die Apotheken ausbaden. Über 60-Jährige und Angehörige von Risikogruppen dürfen sich ab Dienstag – wie schon zuvor in Bremen – deutschlandweit kostenlos FFP2-Masken in den Apotheken abholen. Die Regelung ist bis 31. Dezember gültig, danach soll es im Januar mit einer geringen Eigenbeteiligung über die Krankenkassen Coupons für zwölf weitere Masken geben. Die kostenlose Abgabe kann jedoch kaum kontrolliert werden, Menschen könnten versuchen, sich in mehreren Apotheken auszustatten. Die Kosten von 2,5 Milliarden Euro trägt der Bund. Doch es muss noch mehr passieren, damit dieser zweite harte Lockdown der letzte seiner Art bleiben wird.
Die Alten besser schützen
Das Virus wütet vor allem dort, wo die besonders Gefährdeten leben, die Alten und Vorerkrankten. „Die häufigste Ursache für die Ausbreitung des Virus in den Heimen ist die nicht erkannte Infektion“, sagt der Mediziner und FDP-Bundestagsabgeordnete Andrew Ullmann. Umso wichtiger ist ein umfassendes Konzept, um die sogenannten vulnerablen Gruppen effektiv zu schützen. Doch das gibt es bislang nicht. Vor allem Tests und FFP2-Masken fehlen in den Einrichtungen – ein Versäumnis der Regierung, wie die Opposition betont. „Die Bundesregierung handelt zu spät“, sagt Ullmann. „Wir müssen die vulnerablen Gruppen klüger schützen.“ Fieber-Screenings am Eingang von Heimen, regelmäßige Tests von Mitarbeitern und Bewohnern, strengere Kontrollen der AHA-Regeln – das sind Ullmanns Forderungen.
So ähnlich soll es nun auch umgesetzt werden, doch es läuft schleppend. Am Sonntag haben Bund und Länder beschlossen, das Personal in Altersheimen verpflichtend zu testen. In Corona-Hotspots soll der Zugang zu den Heimen für Angehörige von einem negativen Test abhängig gemacht werden. In einer internen Vorlage des Gesundheitsministeriums heißt es zudem, dass nun sämtliche 33.168 stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen in Deutschland Masken erhalten sollen.
Das Ministerium hatte bis zum Sommer 1,7 Milliarden Stück beschafft. Aber erst seit dem 10. November – als schon zehn Tage der Lockdown Light galt – wird ausgeliefert. Wer ein Pflegeheim besucht, muss oft feststellen, dass das Personal normale OP-Masken trägt und es keine Schnelltests gibt.
Nicht ohne Neid schauen manche auf den „Tübinger Weg“, wie ihn der dortige Grünen-Oberbürgermeister Boris Palmer bewirbt. Dort werden Mitarbeiter der Heime und ambulanten Pflegedienste regelmäßig getestet. „Allen über 65 Jahre haben wir außerdem kostenlos FFP2-Masken zugesandt“, sagte Palmer. „Bei den über 75-Jährigen haben wir zuletzt überhaupt keine Fälle mehr gehabt.“ An dieser Darstellung gibt es aber Zweifel, wie eine „Tagesspiegel“-Recherche zeigt. So wurden vom Kreis Tübingen vorige Woche sieben Fälle in dieser Altersgruppe festgestellt. Auch mindestens zwei Bewohner eines Tübinger Altersheim wurden vergangene Woche als Corona-positiv gemeldet.
Digitalen Fortschritt nutzen
Die Corona-Warn-App erfüllt bisher nicht die anfangs in sie gesetzten hohen Erwartungen. Immer öfter fordern daher Politiker wie Markus Söder, den Datenschutz zu lockern. Welche Änderungen sie wollen, können sie auf Nachfrage jedoch nicht sagen. Der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin schlug am Sonntag bei „Anne Will“ eine Nachverfolgung nach südostasiatischem Vorbild vor. Dabei sollten über GPS auch die Standortdaten und Bewegungsmuster der Menschen und ihre Begegnungen aufgezeichnet werden. Experten wie der Informatiker Henning Tillmann weisen jedoch darauf hin, dass dafür eine komplett neue App entwickelt werden müsste. Denn Apple und Google, über deren Schnittstelle die Kontaktschlüssel derzeit getauscht werden, lassen eine Ortung nicht zu. Ob dann auch noch 24 Millionen Menschen solch eine App nutzen würden, ist fraglich.
Trotzdem könnte die App verbessert werden. Mehr als 200.000 positive Testergebnisse wurden über die Corona-Warn-App registriert. Doch nur wenig mehr als die Hälfte der positiv Getesteten teilte diese Information mit den Kontakten. Daher wurde beim letzten Update eine Erinnerungsfunktion eingeführt. Tillmann fordert beispielsweise ein Kontakttagebuch und eine Clustererkennung. Die App könnte größere Menschengruppen daran erkennen, dass mehrere andere Handys gleichzeitig funken. So könnten „Superspreader-Events“ registriert werden. Die Einführung solcher Funktionen wird derzeit geprüft.
Auch bei der Effektivität der App gibt es eher analoge Probleme. 5,2 Millionen Testergebnisse wurden an die Corona-Warn-App übermittelt. Die Zahl könnte höher sein, denn Nutzer klagen immer noch, dass Ergebnisse in der App nicht ankommen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KVB) warnt vor Fehlern, die in Arztpraxen mit den Formularen gemacht werden. „Kopieren Sie auf keinen Fall das Auftragsformular“, erklärt die KVB. „Der aufgedruckte QR-Code ist für jede Person individuell und kann nur einmal verwendet werden.“ Zudem werden auf Landesebene Geräte für Nutzer getestet, die kein Smartphone besitzen.
In Schleswig-Holstein läuft ein Pilotprojekt mit einem Armband. Im sächsischen Augustusburg wird der Corona-Warn-Buzzer getestet. Das Gerät ähnelt einem Funkschlüssel für das Auto. Zudem können andere Programme als Ergänzung genutzt werden. Das Berliner Start-up Nexenio stellte am Montag die App Luca vor, die vom Rapper Smudo mitentwickelt wurde. Damit sollen Anwesenheitslisten bei Events aber auch in Restaurants oder beim Friseur erstellt werden. Das könnte, wenn die Geschäfte und Restaurants wieder öffnen, die Zettelwirtschaft und das Eintragen unter falschem Namen beenden. Ähnliche Anwendungen gibt es schon, im Unterschied zu diesen soll Luca es jedoch nur den Gesundheitsämtern im Falle einer Infektion ermöglichen, digital auf die Kontaktdaten zugreifen zu können.
Bisher erfolgte das Management der Kontaktverfolgung und Übermittlung in den rund 400 Gesundheitsämtern oft noch mit Papierlisten, Excel-Tabellen und Fax. Dabei gibt es schon eine deutsche Spezialsoftware zur Seuchenbekämpfung. Sie wurde vom Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) zum Kampf gegen Ebola entwickelt und in Ghana und Nigeria erfolgreich eingesetzt. Doch hierzulande nutzt weniger als ein Viertel der Gesundheitsämter das Epidemie-Management-System. Immerhin haben sich Bund und Länder inzwischen auf eine Einführung von Sormas verständigt.
Infektionsgeschehen an Schulen
Noch ist das Infektionsgeschehen an Schulen wissenschaftlich nicht ausreichend erforscht. Die Ironie des jetzt beginnenden Lockdowns ist, dass eine solche begleitende Forschung durch eben diesen Lockdown für dessen Dauer unmöglich wird. Denn um etwa wirklich herauszufinden, welche Rolle Schulen und Kitas als Virenkarusselle spielen, und inwiefern Maßnahmen wie Maskentragen, Klassenhalbierung und dergleichen funktionieren, müsste das auch an den Schulen praktiziert werden.
Eine Wissenschaftlergruppe, bestehend unter anderem aus dem Kölner Professor für Innere Medizin Matthias Schrappe, der Berliner Pflegeexpertin Hedwig François-Kettner und dem Bremer Medizinrechtler Dieter Hart, hat in einem Thesenpapier unter anderem rigorose „prospektive“ Studien gefordert. Hierfür müssten, ähnlich wie bei den Tests der Impfstoffe, „zufällig ausgewählte Bevölkerungsstichproben“, so genannte Kohorten, „regelmäßig auf das Neu-Auftreten einer Infektion mit Covid-19 untersucht werden“. Nur solche Studien erlaubten „zentrale Aussagen zur Häufigkeitsentwicklung, zu den Infektionswegen, zur Symptomatik und zu den Risikogruppen“. Auch der Freiburger Medizinstatistiker und Epidemiologe Gerd Antes, ehemaliger Chef des deutschen Cochrane-Zentrums, das sich der Bewertung der Aussagekraft medizinischer Studien verschrieben hat, sieht in schnell anzuschiebender und intensiver begleitender Forschung die beinahe einzige Möglichkeit, Grundlagen für gezieltes Handeln zu legen.