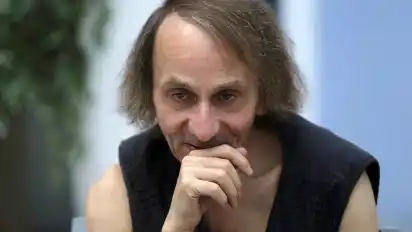Herr Horx, ist Ihr Buch Ausdruck Ihrer Hoffnung oder ein Appell?
Matthias Horx: Appelle sind nicht mein Stil, und sie nutzen meistens gar nicht. Als Zukunftsforscher interessiert mich vor allem, wie Wandel tatsächlich stattfindet. Ich glaube, dass sich in der Gesellschaft durch eine solche Pandemie wie Corona, aber auch durch andere Krisen-Erfahrungen eine Menge ändert, auch wenn es zunächst nicht so aussieht. Dem möchte ich nachspüren. Mein Buch ist vor allem ein Buch über unsere Wahr-Nehmung. Was nehmen wir wahr? Was ignorieren wir?
Momentan sieht es so aus, als ob die Sehnsucht groß wäre, wieder in den alten Trott zurückzufallen. Vom Wunsch nach Normalität ist allenthalben die Rede, nicht von Aufbruch ...
Es ist doch völlig normal, dass man wieder tanzen, feiern, reisen, auch konsumieren will. Ich glaube trotzdem, dass eine sehr große Zahl von Menschen durch Corona eine andere Einstellung zu vielen Dingen gewonnen hat. Man kann das alte Spiel, also die Routinen des „alten Normal“ nicht mehr einfach so weiterspielen, wenn man das erlebt hat. In den USA gibt es die Wortschöpfung „re-entry fear“, also die Angst vorm Wiedereintritt. In den Job, die Routine, den Spaß - das alles wirkt ja plötzlich fremd, manchmal sogar sinnlos. Viele Branchen geraten im Post-Corona in einen echten Umbruch. Viele Konsumbranchen klagen über Kaufmüdigkeit. Die Flugbranche ist ziemlich unter Druck, was die Frage der Klimaerwärmung betrifft. Die E-Mobilität setzt sich viel schneller durch. All das hat sehr viel mit unseren Krisenerfahrungen zu tun. Corona war ein seelischer Schock mit Nachwirkungen. Auch wenn wir oberflächlich so weitermachen (wollen), sind wir innerlich nicht mehr die Gleichen.
Ist es Ihrer Meinung nach überhaupt möglich, die Pandemie als geschlossenes Kapitel abzuhaken und das vorherige fortzuführen?
Vordergründig schon, aber in den Seelen arbeitet es ja weiter. Viele Ehen und Beziehungen sind in Frage gestellt worden. Lebenspläne wurden revidiert. Karriere-Vorstellungen scheinen plötzlich seltsam leer. Corona hat vielen Menschen einen anderen Blick auf ihre Gewohnheiten ermöglicht und eine brutale, aber womöglich heilsame Botschaft mit sich gebracht: Wir sind und bleiben als Menschen Teil der Natur. Wir kommen da auch in einer hochtechnischen Gesellschaft aus dem Naturzusammenhang nicht heraus. Das kann eine frustrierende, aber auch heilsame Erkenntnis sein.
Was erhoffen Sie sich als Überbleibsel der Pandemie? Was würde uns guttun?
Ein „Überbleibsel“ wäre zu wenig. Wir gehen in ein Zeitalter der Transformation, des grundlegenden Wandels unserer Produktions- und Lebensweisen, hin zum Post-fossilen, Ökologischen. Corona könnte ein Weckruf, auch ein Energiestoß gewesen sein. Es ist zum Beispiel in Sachen der globalen Erwärmung ein deutlich höherer Druck, eine größere Entschlossenheit zu spüren, sich wirklich von Öl und Kohle zu verabschieden.
Ein zentraler Begriff Ihres Buchs ist die Regnose – können Sie ihn bitte erläutern?
Das ist eine Art geistige Zeitreise mit dem Ziel, die eigenen Einstellungen zur Zukunft zu überprüfen. In manchen Psychotherapien arbeitet man schon lange mit der Technik, sich mit seinem „zukünftigen Ich“ bekannt zu machen. „Wer wirst Du in 20 Jahren sein?“ Die Regnose ist im Unterschied zur Prognose eine Technik, in der wir geistig in die Zukunft springen und von dort aus zurückblicken. Wir verstehen, dass die Zukunft nicht fixiert ist und nicht wie eine Lokomotive „auf uns zukommt“. Sondern dass wir sie durch unsere Handlungen, Gedanken, Einstellungen selbst produzieren. Wir sehen die Gegenwart von den Lösungen aus, nicht nur aus der Perspektive der Zukunftsangst und der unlösbaren Probleme.
Wo führt Ihrer Einschätzung nach kein Weg mehr in die Zeit vor der Pandemie zurück?
Es führt kein wirklicher Weg mehr zurück in die alte Arbeitswelt. Hier wird vieles neu ausverhandelt werden. Wir haben in der Pandemie ja etwas Verblüffendes erlebt: Die Anwesenheit löste sich auf, aber die Organisationen lebten immer noch weiter. Nach der Pandemie ist Arbeit plötzlich unglaublich begehrt und knapp. In Amerika spricht man bereits von der „Great Resignation“, dem großen Rücktritt. In vielen Branchen, etwa der Gastronomie, haben viele Mitarbeiter nicht mehr ihren Job angetreten. Hierzulande sieht man das auch – in der Landwirtschaft, im Bau, bei den Lastwagenfahrern, zum Teil auch beim Pflegepersonal. Viele Menschen wollen flexibler arbeiten, in Zukunft. Endlich! Und viele Menschen wollen ihr Medienverhalten ändern. Sich selbst geistig klarer machen.
Führt die Krise also zu einer Generation Aussteiger? Und: Wer ist das? Die Alten, die Jungen, eine gewisse Elite, alle?
Generationen sind nicht homogen. Und „Elite“ ist ein sehr schwammiger Begriff. Nein, solche Krisen wirken breitflächig, Altersgruppe oder Schicht spielen dabei weniger eine Rolle. Was getestet wird, ist doch vielmehr unsere innere Resilienz, unsere Fähigkeit, zu lernen und menschlich zu wachsen. „When things break“, sagt man im Englischen, „we have an opportunity". Wenn etwas zerbricht, eröffnen sich neue Chancen. Und das gilt unabhängig von Klassen oder Geld. Manche Menschen haben sich diesem Wachstum verweigert, indem sie sich in paranoische Vorstellungen und Verschwörungswahn geflüchtet haben. Das gehört wohl auch dazu.
Welche Veränderungen erkennen Sie an sich und/oder Ihrer Umgebung?
Ich habe in der Pandemie erlebt, was wahrscheinlich viele erlebten: Das unmittelbare Umfeld, die Familie, die Freunde, wurden plötzlich viel wichtiger. Und kostbarer. Die Vögel zwitschern ganz anders. Da war in der Verletzlichkeit auch eine Dankbarkeit über das, was einen mit der Welt und anderen Menschen verbindet ...
Sie stellen fest, dass im Vergleich zu den ewigen Lobpreisungen des Digitalen die Zerstörungen, die Digitalität in den Strukturen der menschlichen Kommunikation angerichtet hat, kein allzu großes Thema seien. Wie erklären Sie sich das?
Corona hat uns einerseits zwangsdigitalisiert. Sozusagen „verzoomt“, aber auch drastisch die Grenzen des Digitalen aufgezeigt. Weil wir gespürt haben, wie sehr wir als Bindungswesen immer auch auf direkten, menschlichen, analogen Kontakt angewiesen sind. Gleichzeitig hat die Krise noch einmal gezeigt, wie verkommen das Internet eigentlich ist - es ist eine Wüste von Lüge, Hass, Denunziation, Negativität, Narzissmus, Betrug und Dummheit geworden. Wir haben uns daran gewöhnt, weil die „sozialen Medien“ auf Suchtmechanismen beruhen, denen wir uns nur schwer entziehen können und die von den großen Plattformen gnadenlos angewandt werden, um Werbung zu verkaufen. Die Pandemie hat gezeigt, wie gefährlich marodierende Gerüchte und Fehlinformationen in einer Situation sind, in der wir alle auf gemeinsames Handeln und verlässliche Information angewiesen sind. Wir können mit dieser toxischen Medialität nicht weiterleben.
Sie hoffen auf „digitale Emanzipation“. Was verstehen Sie darunter?
Dass wir lernen, mit digitalen Medien sinnvoll umzugehen. Für manche Dinge ist Digitalisierung sinnvoll, für andere nicht. Das unterscheiden zu können, ist vielleicht die wichtigste Aufgabe der näheren Zukunft. Lernen zum Beispiel, lebendige Schule, lässt sich einfach nicht völlig digitalisieren. Es braucht immer auch die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer, auf einer sehr analogen und persönlichen Ebene. Wissen basiert immer auf Beziehungen.
Statt von „Fake News“ schreiben Sie von „Fake Feelings“ – was ist das?
Es gibt ein Grundparadox der Aufmerksamkeitsökonomie: Dass sie Zuneigung und Sympathie nur simuliert. Der Physiker Michael Goldhaber hat schon vor 25 Jahren in einem legendären Artikel in der Zeitschrift "Wired" geschrieben: „Zunächst einmal adressiert Aufmerksamkeit ein fundamentales menschliches Bedürfnis. Aufmerksamkeit ist aber gleichzeitig streng limitiert – wir können echte Aufmerksamkeiten nicht teilen. Im Netz muss aber jeder so tun, als würde er seine Aufmerksamkeit genau auf ein Individuum richten. Der Adressat muss zumindest eine illusorische Aufmerksamkeit zurückbekommen.“ Das Netz nutzt also „gefakte Gefühle“, aber es gibt keine wahren Beziehungen zurück. Viele Menschen spüren das, sie reagieren mit Enttäuschung, Wut und schließlich mit Hass. Oder sie verirren sich in narzisstischen Selbstdarstellungen, wie viele Influencer, die dann an sich selbst scheitern.
In Ihrem Buch taucht der Begriff „Concept Creep“ auf. Vielleicht kann man zusammenfassend von Dramatisierung sprechen – sehen Sie da eine Trendwende?
„Concept Creep“ besteht darin, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft immer mehr Phänomene hysterisieren. Was früher normal war, ist plötzlich ein Weltuntergang, Nebenphänomene werden ins Unendliche aufgebläht, und irgendwann schreien alle nur noch durcheinander. Die Maßlosigkeit der Bewertungen, die ständige Moralisierung führen zu einer Art Entzündung öffentlicher Meinungen, einer regelrechten Angst-Erregungs-Spirale, in der irgendwann kein rationaler Diskurs mehr möglich ist. So entsteht eine Art Weltuntergangshysterie. Aber es gibt immerhin auch Bewegungen der Achtsamkeit und Moderation. Sogar einen neuen Trend zum konstruktiven Journalismus, der nicht immer nur Untergang und Skandal heraufbeschwört. Immerhin.
Was kann man tun, um sich nicht ins Bockshorn jagen zu lassen?
Es ist sicher kein Zufall, dass sich Meditations- und Kontemplationstechniken immer weiter durchsetzen. Ratsam ist, dem ständigen Mimimi, dem unentwegten Gejammer und Geschrei eine Art aktive Gelassenheit entgegenzustellen und sich selbst einzubringen. Ich sehe, dass sich viele, viele Menschen heute neu gesellschaftlich engagieren. Allerdings liegt der Aufmerksamkeitsfokus eher immer auf denen, die negativen Krawall veranstalten.
Gibt es Ihrer Meinung nach Hoffnung, dass die Pandemie – und vielleicht auch die Hochwasser-Katastrophe – uns auf ein rechtes Maß zurechtstutzt, was unsere Ansprüche betrifft – an die Gesellschaft, an die Politik, an unser Leben und an uns selbst?
Wir erwarten totale Sicherheit vom Leben, und das vor allem vom Staat. Allerdings zeigt sich in der Geschichte, dass Menschen gerade in Krisen erstaunlich kreativ und durchaus hilfsbereit werden können. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in Wahrheit höher als wir denken.
Was sollen Leserinnen und Leser Ihres Buchs tun? Was erhoffen Sie sich?
Über dem Eingangstor des Orakels von Delphi prangte der Satz: Erkenne dich selbst. Das wünsche ich mir vor allem: Dass Menschen den Mut haben, sich selbst besser kennenzulernen, ihre Gedanken und inneren Konstrukte zu verstehen. Dabei kommt man ziemlich schnell darauf, dass die eigenen Meinungen und Ängste nicht unbedingt mit der Realität zu tun haben. Das macht auf verblüffende Weise frei.
In einem Kommentar in der "Frankfurter Allgemeinen" war unlängst zu lesen: "In der Katastrophe zeigt sich die deutsche Gesellschaft leistungsfähiger, stabiler und bewundernswerter, als ihr mitunter attestiert wird. Es wäre gut, wenn das auch in der Corona-Krise so wäre". Teilen Sie diese Einschätzung?
Machen wir ein Gedankenexperiment, eine Mini-Regnose: Was wäre, wenn wir diese Pandemie recht gut bewältigt hätten? So ein Gedanke ist undenkbar, in jeder Talkshow würde man dafür niedergemacht. Aber eine große Krise wie Corona ist immer ein Paradox. Die Politik macht immer alles falsch - wenn sie Lockdowns verhängt oder nicht, wenn sie schnell impft oder weniger schnell, wenn sie den Wissenschaftlern glaubt oder nicht. Man kann nie etwas richtig richtig machen. Könnte es sein, dass man durch ein solch gewaltiges Ereignis nur durch Irrtum und Korrektur „hindurchstolpern“ konnte? Und dass wir es „den Umständen entsprechend“ doch ganz gut hingekriegt haben? Dass Politik, Pharmaindustrie und selbst die Bürger großteils recht vernünftig reagiert haben? Man vergleiche einmal Corona mit früheren Pandemien. Und mit dem, was nicht passiert ist: Die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, die Corona-Freaks haben nicht den Reichstag gestürmt, im Gegenteil: Die Populisten haben in vielen Ländern verloren. Gelingt es uns, diese schwierige Zeit einmal aus dieser Sicht zu sehen? Ich glaube, dann würden wir die Zukunft auf andere Weise verstehen als immer nur durch Angst, Panik und schlechte Laune.
Das Gespräch führte Silke Hellwig.