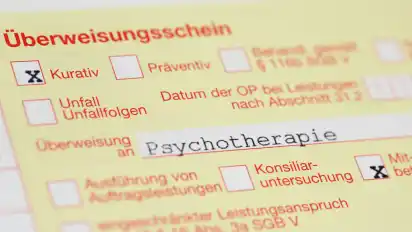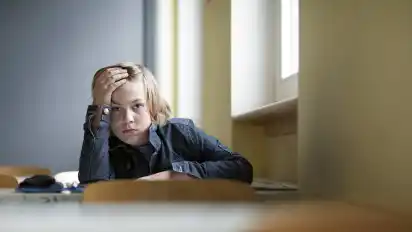Triggerwarnung: In dieser Serie werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizidgedanken thematisiert.
Die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung berichtet von einer Zunahme der Anfragen an Therapieplätzen von 40 Prozent während der Pandemie. Wie ist die Lage in Bremen?
Christoph Sülz: Wir haben in Bremen eine relative hohe Nachfrage trotz der vermeintlich hohen Anzahl an psychotherapeutischen Praxen. Das liegt daran, dass wir eine Bedarfsplanung haben, die nicht mehr an den Bedürfnissen angepasst ist. Rein von der Statistik her scheint die Menge der Praxen ausreichend. Wir merken aber ganz konkret im Alltag, und das auch schon vor Corona, wie immer mehr Anfragen in den Praxen einlaufen, die wir nicht mehr bedienen können.
Es gibt eine gedeckelte Anzahl an kassenärztlichen Versorgungsaufträgen, die durch eine Bedarfsplanung festgesetzt wird – die haben Sie gerade schon angesprochen. Nun können Betroffene aber, falls sie keinen Platz bei einer Vertragspraxis finden, und dies auch belegen können, auch zu einer privaten Praxis gehen, sich dort behandeln lassen und sich das Geld von der Krankenkasse wiederholen.
Genau, es gibt grundsätzlich im Sozialgesetzbuch die Möglichkeit der Kostenerstattung. Ich beschaffe mir also eine Leistung, die mir das System nicht zur Verfügung stellen kann, selber. Die Krankenkasse ist dann verpflichtet, die Kosten bei bestimmten Maßgaben zu übernehmen. Hier gilt es aber unbedingt, im Vorfeld einer Behandlung eine Kostenübernahmeerklärung von der Krankenkasse einzuholen.
Nun sind Vertragspraxen aber auch gesetzlich zu psychotherapeutischen Sprechstunden verpflichtet. Also müssen Sie eine gewisse Kapazität für Erstgespräche haben?
Wir sind da in einem Dilemma. Einerseits sind wir verpflichtet, Erstgespräche anzubieten. Wir wollen natürlich auch, dass Menschen ins System reinkommen und versorgt werden. Gleichzeitig haben wir aber laufende Behandlungen und die sind in der Psychotherapie immer zeitgebunden. Im Gegensatz zum Hausarzt, der eine größere Anzahl von Patienten pro Tag behandelt. Wir sind begrenzt in der Menge an Patienten, die wir am Tag sehen können. Eine Sitzung dauert in der Regel 50 Minuten, das heißt, ich komme auf maximal acht oder neun Patienten am Tag. Da wir unsere Patienten nicht im Akkord behandeln, sondern individuell, lässt es sich auch nicht immer exakt hochrechnen, wann eine Therapie zu Ende ist. Deshalb ist das so schwer planbar. Also wenn heute jemand anruft, sage ich im Regelfall auch keine Zahl, um keine falsche Hoffnung zu schüren, dass in fünf oder sechs Monaten bei mir was frei wird.
Brauchen wir also mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten?
Das ist eine Forderung, die immer wieder laut wird. Die wird aber nur begrenzt greifen können. Möglicherweise braucht es andere Versorgungsformen. Ich habe eben die Zeitgebundenheit angesprochen, da bräuchte es mehr Flexibilität. Nicht alle Patienten brauchen die 50 Minuten. Stellen Sie sich einen schwer Depressiven vor mit einer Konzentrationsschwäche, der ist häufig gar nicht in der Lage, hier so lange zu sitzen. Heißt, dort haben wir die Möglichkeiten auf vielleicht 25 Minuten zu halbieren. Es wäre in meiner Vorstellung aber auch wünschenswert, da zeitlich noch flexibler zu sein. Da brauchen wir noch mehr Innovationen.
Es gibt ja durch die Pandemie mehr digitale Angebote, neue Internetseiten, die auch von den Krankenkassen unterstützt werden. Was halten Sie davon?
Für uns ist immer wichtig, zu gucken: Sind dort, wo psychotherapeutische Inhalte versprochen werden, auch Psychotherapeuten beteiligt? Oder ist es eher eine Beratung? Das muss nicht schlecht sein, ist aber keine Psychotherapie. Grundsätzlich ist es für Fragen der Selbstbeobachtung oder der Tagesstrukturierung bestimmt hilfreich, auf solche Angebote zurückzugreifen – für bestimmte Gruppen, aber eben nicht für alle. So ein digitales Angebot kann unterstützend hilfreich sein, aber keine Psychotherapie ersetzen.
Wie erkenne ich, was ich brauche?
Meine Empfehlung wäre tatsächlich immer, zum Profi zu gehen und sich die Beratung einzufordern. Das machen wir über die psychotherapeutische Sprechstunde. Wenn Menschen so zu mir in die Praxis kommen, mache ich genau das: Ich höre mir erst einmal an, was das Problem ist, wo der Schuh drückt. Und dann überlegen wir gemeinsam: Was braucht es? Und oft hilft es schon, eine Idee vom Versorgungssystem aufzeigen zu können. Es gibt niederschwellige Beratungsangebote in den sozialpsychiatrischen Beratungsstellen. Manche Menschen brauchen auch eher juristische oder sozialrechtliche Beratung. Die Rentenversicherungen sind beispielsweise auch Anbieter für psychosomatische Reha. Da können wir vielfältig beraten und sind dann auch gut vernetzt.
Wie gehen die Menschen, die Sie bereits betreuen, mit der Pandemie um?
Hier ist wieder ein differenzierter Blick notwendig. Die Pandemie hat Einigen etwas Druck genommen. Das sind typischerweise Angstpatienten, die es sowieso vermeiden, aus dem Haus zu gehen – die erleben eine Entlastung, zumindest am Beginn der Pandemie. Aber all diejenigen, die darauf angewiesen sind, gesundheitsförderliche Aspekte nutzen zu können wie sozialen Kontakt, das Rauskommen oder Bewegungsangebote, die erleben massive Einschränkungen. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Befunde, nicht nur aus Deutschland und Europa, sondern aus der ganzen Welt. Es sind primär diejenigen, die vorher schon psychisch belastet waren, die statistisch bewiesen sehr leiden. Diese Gruppe fühlt sich mehr eingeschränkt als die körperlich Kranken. Die körperlich Kranken haben vorher auch schon Einschränkungen gehabt, das heißt das Mehr an Einschränkungen bringt gar keine große Veränderung. Aber bei den psychisch Kranken, da sehen wir deutlich mehr Leid, deutlich mehr Belastung durch die Pandemie.
In einem Gespräch nannte es eine Betroffene Retraumatisierung: Gefühle, die wir alle wegen der Pandemie empfinden, wie Angst oder Schuld, könnten bei Menschen mit Traumata alte Wunden aufreißen. Ist der Begriff richtig?
Ich würde da eher von Triggern sprechen. Bestimmte Reize, die so ein Angsterleben wieder aktivieren können. Das kennen wir grundsätzlich bei Menschen, die traumatisierende Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben. Das können Reize jeglicher Art sein: ein Geruch, ein situativer Reiz oder ein optischer Eindruck oder auch eine Emotion. Und es ist schon naheliegend, dass manche Erlebnisse bestimmte Emotionen in dieser Pandemie-Situation triggern können.
Wie sehr wird Corona selbst für Traumata sorgen?
Es wird sicherlich eine Gruppe von Betroffenen geben, die nachhaltig Schäden davon tragen wird. Konkret lässt sich das schwer vorhersagen. Es gibt Hinweise, dass bestimmte Faktoren Risiken darstellen, die gilt es im Vorfeld der Behandlung zu beachten. Gerade die Patienten der Intensivstation, die im Koma lagen und künstlich beatmet wurden, haben ein erhöhtes Risiko. Da geht es um Kontrollverlust: Es wird etwas mit mir gemacht, ohne dass ich mich wehren kann. Für bestimmte Gruppen kann solch eine Intensivbehandlung – und fairerweise muss man da sagen: auch unabhängig von Corona – traumatisierend sein. Am Anfang der Pandemie gab es zudem ein großes Problem mit Stigmatisierung. Ärzte waren überfordert: Wie gehe ich mit diesen Infizierten um? Es gab Empfehlungen, diese nicht in die Praxen zu lassen. Oder Rettungssanitäter, die sich dagegen gewehrt haben, Corona-Patienten mitzunehmen. Auch das schürte Ängste. Und Infizierte mit einem schweren Verlauf, die immer wieder durch Luftnot Todesangst verspüren. Das Gefühl zu haben: Ich geh jetzt ins Bett, schlaf ein und weiß nicht, ob ich morgen wieder wach werde, weil ich so schlecht Luft kriege. Das ist ganz massiv beängstigend.
Viele Menschen empfinden momentan eine Art Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Wie können Betroffene erkennen, dass es nicht nur eine schlechte Phase ist, sondern dass sie professionelle Hilfe brauchen?
Da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist die offizielle Klassifikation der WHO: Welche Symptome müssen da sein, damit ich von einer Depression sprechen kann? Die Hauptsymptome sind: Eine niedergeschlagene Stimmung, Verlust von Freude und Antriebsmangel. Im ICD-10, eine internationale Klassifikation der Krankheiten des WHOs, kann ich Symptome nachschauen und gucken, was zutrifft. Was aber tatsächlich viel alltagsnäher ist, ist ein anderes Kriterium: Wo entsteht Leid? Wenn ich darunter leide, ist es ernst zu nehmen. Und auch wenn mein Umfeld darunter leidet. Manchmal ist mir selbst nicht bewusst, dass ich die ganze Zeit super gereizt und genervt bin, mein Umfeld leidet aber darunter. Das könnten Hinweise sein, darüber mit dem Hausarzt oder einem Psychotherapeuten drüber zu sprechen. Denn wenn man genauer nachhakt, kommen meist neben der Verstimmtheit auch Schlafstörungen oder körperliche Ermüdung und Energielosigkeit als typische Symptome hinzu. Wenn man merkt, es geht mir nicht gut, dann sollte man zum Fachmann oder zur Fachfrau gehen. Und da ist auch niemand böse, wenn man ein zweites Mal kommt. Die Schäden, die entstehen können, wenn man es nicht macht, sind für den Einzelnen, aber auch für das Umfeld erheblich. Und therapeutische oder auch medizinische Ansätze helfen, Leid zu lindern.
Nun ist auch die Durchführung Ihrer Therapie von den Maßnahmen betroffen. Finden die Stunden in Präsenz statt?
Ich wäge ab, wer kommt. Präsenz muss stattfinden bei Menschen, die zuhause keinen Computer oder Internetanschluss haben. Es gibt aber auch unabhängig davon Patienten, wo es die Präsenz braucht. Ich möchte die dann sehen, brauche den ganz konkreten Eindruck. Bei anderen kann ich das Digitale gut verantworten. Und wir haben den Vorteil: Vorm PC sitzen wir ohne Maske. Wer bei mir in der Praxis ist, der muss eine Maske tragen. Da gehen in Präsenz durch den Gesichtsausdruck, was die Emotionen angeht, Informationen verloren. Ich muss so immer ganz genau auf die Augen achten und auf die Körpersprache gucken, um mitzubekommen, was passiert da gerade bei meinem Gegenüber?
Geht durch die Videokonferenz nicht auch was verloren?
Das hängt von den einzelnen Patienten ab. Ich habe einen Patienten gehabt, der am Ende der Videositzung aufstand und dann den Kopf schüttelte und zu mir sagte „Ich wollte gerade meine Jacke anziehen“. Darauf kommt es an: Wie intensiv komme ich in die Behandlung und in das Setting rein? Das ist möglich, was mich auch erstaunt hat. Dass diese Distanz, die durch die Technik geschaffen wird, häufig gar nicht so groß ist.
Aber die Patienten müssen sich dann zuhause ihren Safespace, ihre sichere Therapieumgebung alleine schaffen?
Und es kommt noch dazu: Vielleicht möchte ich gar nicht, dass mein Psychotherapeut mein Wohnzimmer sieht. Weil das mein privater Raum ist. Das besprechen wir vorher mit den Patienten. Einen geschützten Raum zu schaffen, funktioniert auch nicht, wenn Kinder oder Angehörige mit im Raum sind. Unter solchen Umständen würde ich dann sagen: Kommen Sie in die Praxis.
Gibt es wegen der Pandemie neue spezielle Angebote für Personen in Notsituationen?
Wir als Psychotherapeutenkammer haben mit der Gesundheitsbehörde, der kassenärztlichen Vereinigung und der Ambulanz der Berufsgenossenschaft Sprechstunden extra für Menschen aus helfenden medizinischen Berufen ermöglicht. Wie Pflegepersonal beispielsweise. Beruflich besonders betroffene Menschen haben so eine Chance, in den Praxen ohne lange Wartezeit einen Sprechstundentermin zu bekommen. Es wäre schön, wenn das Angebot weiter ausgebaut wird.