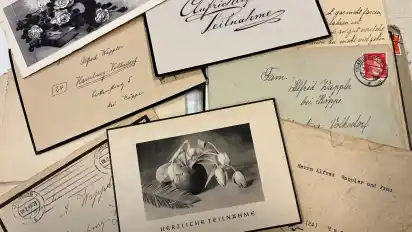Vom Bremer Westen war nach dem verheerenden Luftangriff vom 18./19. August 1944 so gut wie nichts stehen geblieben. Zu den wenigen Überresten inmitten der apokalyptischen Trümmerlandschaft zählte der 65 Meter hohe Turm der Wilhadi-Kirche in Walle. "Der einsame alte Kirchturm, der ohne Kirchenschiff an der Nordstraße stand, hat mich als Kind und Jugendlicher sehr beeindruckt", sagt der Stadtteilforscher Peter Strotmann. Doch eine Zukunft hatte der Sakralbau nicht: Vor 60 Jahren, am 14. April 1964, sprach sich die Baudeputation für den Abbruch der Turmruine aus.
Völlig überraschend kam die Entscheidung nicht, schon länger hatte die neugotische Turmruine auf der Kippe gestanden. Das Backstein-Bauwerk stammte aus den sogenannten Gründerjahren – eine Wortschöpfung, die sich von der Reichsgründung 1871 ableitet. Erst war 1878 das Kirchenschiff fertiggestellt worden, 1886 auch der Turm. Bereits im Oktober 1962 hatte sich die Baudeputation zum ersten Mal für dessen Beseitigung ausgesprochen. Die damalige Begründung: "Die Turmruine der Wilhadi-Kirche ist durch Witterungseinflüsse so schadhaft geworden, dass sie für spielende Kinder und Passanten eine Gefahr bedeutet."
Tatsächlich hegte das Bauaufsichtsamt ernste Sicherheitsbedenken. Darauf weist Iris Johanna Bauer in ihrem Beitrag für das Bremische Jahrbuch hin. Eine abschließende Prüfung durch Fachleute ließ allerdings auf sich warten. Erst im Spätsommer 1963 wurde die Turmruine eingerüstet, um das Mauerwerk gründlich unter die Lupe zu nehmen. Der praktische Nebeneffekt: Ein Gerüst wurde für beide Optionen benötigt, Abbruch oder Sanierung. Eine Sprengung kam offenbar nicht in Betracht, die Ruine musste Stein für Stein abgetragen werden. Was dann tatsächlich auch geschah. Im Juli 1964 war das letzte Überbleibsel des alten Bremer Westens ein für allemal verschwunden, nur ein kleiner Mauerrest blieb stehen.
Damit vollzog Bremen doch noch, was der erste Bebauungsplan der Nachkriegsjahre für das geschundene Areal ohnedies vorgesehen hatte. Die großflächigen Zerstörungen sahen die Stadtplaner als willkommene Chance für einen quasi idealen Neuanfang nach Grundsätzen des modernen Städtebaus. Nicht dicht gedrängt sollten die Häuser stehen, sondern ausreichend Grünflächen vorhanden sein. Ein weiterer Gesichtspunkt: die strikte Trennung von Wohnbauten und gesellschaftlichen Einrichtungen. Für die Wilhadi-Ruine gab es in diesen Planungen keinen Platz.
Doch in den frühen 1950er-Jahren rückte die Baubehörde von ihren ursprünglichen Absichten ab. Nun herrschte plötzlich weitgehende Einigkeit darüber, den "mahnenden Zeigefinger" beim Wiederaufbau des Bremer Westens zu erhalten. Die Ruine sollte nicht nur als Gedenkstätte für die mehr als 1000 Todesopfer des "Feuersturms" im August 1944 dienen. Wie das Mahnmal St. Nikolai in Hamburg oder die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin sollte der Wilhadi-Turm zugleich die Schrecken des Bombenkriegs vor Augen führen und eine bleibende Anklage gegen den Krieg überhaupt sein.

Großflächig beschmiert: der letzte Mauerrest der früheren Wilhadi-Kirche an der Nordstraße in Walle. Im Rasen ist die mit Grünbelag überzogene Gedenkplatte zu sehen.
Treibender Faktor des Sinneswandels war die einflussreiche Aufbaugemeinschaft um den Kaufmann Gerhard Iversen, ab 1954 Mitglied der CDU. Wobei der Arbeitskreis West der Aufbaugemeinschaft betonte, den Turmerhalt keineswegs aus eigener Initiative propagiert zu haben. Vielmehr sei man den Wünschen und Anregungen aus dem Mitgliederkreis und der Bevölkerung der westlichen Vorstadt nachgekommen. Ein wenig anders liest sich der Vorgang bei Turmexpertin Bauer. Nach ihrer Darstellung entwickelte sich die Idee ab 1950 innerhalb der Aufbaugemeinschaft. Als "eine Art Gründungsmythos" für den Bau einer Gedächtnisstätte nennt sie den vielfach verbreiteten Bericht des Wilhadi-Pastors Max Penzel. Allerdings verfasste Penzel seinen Rückblick erst 1954 zum zehnten Jahrestag der Schreckensnacht. Bis heute ist seine Darstellung auf der Website der Wilhadi-Gemeinde zu finden.
Neben der Aufbaugemeinschaft, der Kirchengemeinde, der Lüder-von-Bentheim-Gesellschaft und der Denkmalpflege setzte sich zunächst auch der Bürgerverein für die westliche Vorstadt für die Turmruine ein. So viele Fürsprecher hinterließen offensichtlich Eindruck bei der Baubehörde – der Bebauungsplan wurde geändert, sogar ein Wettbewerb zur Gestaltung der Grünfläche rund um die Turmruine ausgeschrieben. Mit einiger Euphorie steuerten auch Architekten der Aufbaugemeinschaft eigene Ideen zur Gestaltung des Mahnmals bei. Alles schien sich in die von der Aufbaugemeinschaft gewünschte Richtung zu entwickeln.
Doch Iversen und seine Mitstreiter hatten sich zu früh gefreut. "Zu einem Konflikt wurde die Angelegenheit ab 1956", schreibt Bauer. Als Auslöser nennt sie einen kritischen Artikel in der Bremer Bürger-Zeitung (BBZ), dem damals noch wirkungsmächtigen Parteiblatt der SPD. "Dieser Turm steht absolut fremd und verlassen in seiner Umgebung", schrieb die BBZ im Juli 1957. Von diesem "Turm-Torso" könne keine weihevolle Stimmung ausgehen. "Der neue Westen ist Symbol eines neuen Anfangs. Er hat sein eigenes Gesicht. Was dabei stört, ist jene überfällige Turmruine."
Das war eine klare Abrissforderung. Die Baubehörde war sich ihrer Sache nun nicht mehr sicher, zumal die Jahre nicht spurlos an der Turmruine vorübergingen. Aus Geldmangel änderte sich vorerst nichts – der lädierte Kirchturm blieb stehen, während die Neubebauung ringsum allmählich Gestalt annahm. Um nicht untätig zu bleiben, sammelte die Aufbaugemeinschaft fleißig Spendengelder. Sollten finanzielle Argumente für den Abriss in die Waagschale geworfen werden, wollte man nicht mit leeren Händen dastehen.
Die Haltung der Kirchengemeinde spielte bei den weiteren Planungen keine Rolle mehr. Seit 1956 wurde der Kirchenneubau am Steffensweg genutzt, im gleichen Jahr hatte die Gemeinde die Turmruine für 25.000 Mark an die Stadt verkauft. Allerdings im guten Glauben, die Stadt wolle den Turm erhalten, so der zürnende Iversen im November 1962 in einem Schreiben an Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD). Den Verantwortlichen rechnete Iversen mehrfach vor, dass Abbruch- und Erwerbskosten des Turms nahezu identisch mit den Sanierungskosten seien. Zuletzt sprach er von 115.000 gegenüber 120.000 Mark. Die Differenz lasse sich mühelos durch Spenden begleichen.
Doch die Befürworter eines Turmerhalts gerieten zusehends in die Defensive. Eine ähnliche Entwicklung wie bei den vergeblichen Versuchen, die Reste der Ansgarii-Kirche in der Innenstadt als Gedenkstätte zu sichern. Als endgültiger Dammbruch erscheint die abrupte Kehrtwende des Bürgervereins für die westliche Vorstadt. Bei einer Mitgliederversammlung im September 1961 sprach der Vorsitzende Friedrich Paleschke dem umstrittenen Kirchturm nicht nur jeden architektonischen Wert ab. Wenn die Nordstraße wie geplant ausgebaut werde, sei die Ruine auch noch ein "ärgerlicher Steh-im-Weg". Abgesehen davon gebe es in Bremen schon zahlreiche Ehrenmale, deren Pflege das Gartenbauamt schon jetzt kaum noch gewährleisten könne. Laut WESER-KURIER stimmte die überwiegende Mehrheit der anwesenden Mitglieder gegen den Erhalt der Turmruine.
Empört reagierte die Aufbaugemeinschaft, die Paleschke ein durchsichtiges Manöver vorwarf. Der Beschluss sei ohne vorherige Bekanntgabe der Tagesordnung gefasst worden – sonst "wäre die Mitgliederversammlung auch von den Freunden des Turmes besucht worden, die ihr Veto eingelegt hätten". Der Vorstand des Bürgervereins habe "aus vollkommen unverständlichen Gründen" seine frühere Position aufgegeben. Darüber kam es zu einem jahrelangen publizistischen Schlagabtausch. Noch im April 1964 ließ Paleschke wissen, die Aufbaugemeinschaft sei als Interessengemeinschaft der Geschäftswelt der Innenstadt gegründet worden und habe dort ihr Betätigungsfeld. "Sie überschreitet ihre Zuständigkeit, wenn sie auch in Angelegenheiten der Vorstädte hineinredet."
Zum Showdown kam es dann am 14. April 1964, als sich die Baudeputation zum zweiten Mal mit der Abrissfrage befasste. Anscheinend geschah das jedoch nicht auf Grundlage eines Abschlussgutachtens – im WESER-KURIER war von "städtebaulichen und verkehrsplanerischen Gründen" die Rede. In dieser entscheidenden Sitzung stimmte außer den CDU- und FDP-Vertretern auch ein SPD-Mitglied für den Erhalt der Turmruine. Ebenso viele Sozialdemokraten aber dagegen. Ein engerer Ausgang als erwartet, aber dennoch das Aus für die Ruine. "Die Stimmengleichheit ergab somit die Ablehnung und damit war der Abbruch des Turmes endgültig beschlossen", so der frustrierte Iversen im Mai 1965 in der Verbandszeitschrift "Der Aufbau".
Der engagierte Christ konnte seine Verärgerung nicht verhehlen. In seinem Resümee grollte er, dieses stadtgeschichtliche Dokument sei ausgelöscht worden, "weil es ein Kirchturm war". Heute wirkt der einstige Wilhadi-Standort stark vernachlässigt: Der Mauerrest ist großflächig beschmiert, die unscheinbare Gedenkplatte mit Grünbelag überzogen. "Darum kümmert sich keiner", sagt eine Anwohnerin.