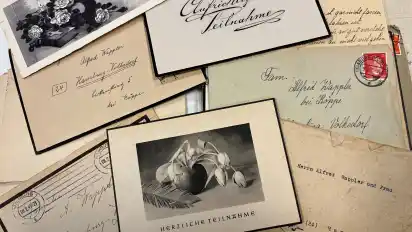Die letzte Nachricht ihres Sohnes erhielt Gertrud Wappler am 2. Januar 1945. Der besorgten Mutter fiel ein Stein vom Herzen. "Du wirst verstehen, wie ungeduldig ich gewartet habe", antwortete sie ihrem "Hansi", dem jüngeren ihrer beiden Söhne. Zu diesem Zeitpunkt war eine Woche vergangen, seit sie von ihm gehört hatte – am ersten Weihnachtstag war der bis dahin letzte Feldpostbrief eingetroffen. Wirklich beruhigt war die 45-Jährige allerdings nicht. Über die schweren Kämpfe in seinem Einsatzgebiet, dem Kessel von Kurland – heute ein Teil Lettlands – wusste sie natürlich Bescheid, nicht zuletzt durch die Wochenschau. "Ein Wahnsinn, wenn man so etwas sich noch ansieht."
Mit jedem Tag, der ohne Lebenszeichen ihres Sohnes verging, wurde Gertrud Wappler unruhiger. Ablesen lässt sich das in ihren langen Briefen, die sie weiterhin an ihren Sohn in der Ferne richtete. "Von einem Tag zum andern diese wahnsinnige Enttäuschung, wenn keine Post kommt", schrieb sie ihm am 12. Januar 1945. Die Ungewissheit zermürbte die Mutter, sie stand kurz vor einem psychischen Zusammenbruch. "Ohne Antwortbrief kommt nichts mehr zustande." Den letzten Brief an ihn verfasste sie am 23. Januar 1945. Auch am sonst so zuversichtlichen Vater nagte die Sorge um den Sohn. "Unser Hansi hat Glück, sagt Papa. Aber er läßt den Kopf hängen." Der Postbote laufe täglich vorbei, konstatierte die Mutter.
Irgendwann in diesen Tagen lief er nicht mehr vorbei. Per Einschreiben traf die Todesnachricht ein. In einem knapp anderthalbseitigen Schreiben teilte der stellvertretende Kompanieführer dem Vater mit, der Gefreite Hans Wappler habe am 24. Dezember 1944 "für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod" gefunden – eine gängige Standardfloskel, die damals auch häufig in Todesanzeigen zu lesen war. Am Heiligen Abend habe sein Zug den Auftrag erhalten, den in ein Waldgelände eingedrungenen Russen zurückzuwerfen. "Bei diesem Unternehmen und im schneidigen Vorgehen wurde Ihr lieber Sohn durch den Splitter eines russischen Artilleriegeschosses am Hals so schwer verwundet, dass der Tod auf der Stelle eintrat."
Die verzweifelten Briefe der Mutter und die Nachricht vom "Heldentod" ihres Sohnes finden sich unter den kleinen Erwerbungen des Bremer Staatsarchivs. Hans' älterer Bruder Alfred Wappler hat die Briefe dem Staatsarchiv übergeben. Zurückgekommen waren sie mit dem handschriftlichen Vermerk "Empfänger gefallen für Großdeutschland". Die Schreiben gehören zu einem Bestand, der die letzten drei Lebensjahre von Hans Wappler beleuchtet. Eigentlich war er ein gebürtiger Hamburger. Dass sein Nachlass trotzdem im Bremer Staatsarchiv liegt, hängt mit seinem Bruder zusammen, der in den 1950er-Jahren berufsbedingt an die Weser zog. Den größten Teil der Unterlagen machen die Briefe aus, die Hans seinen Eltern erst als Angehöriger des Reichsarbeitsdiensts, dann ab Oktober 1942 als Soldat schrieb – mit noch nicht einmal 18 Jahren wurde er eingezogen, seine Lehre bei der Sparkasse währte kaum fünf Wochen.
Daneben finden sich eine Reihe von Fotos, die den schlaksigen jungen Mann mal allein in Uniform, mal mit seinen Eltern und dem Bruder zeigen. Dann noch eine Leihkarte der Bibliothek, der Wehrpass, mehrere Briefe eines Kameraden aus Wilhelmshaven, der in den Nachkriegsjahren die trauernde Mutter besuchte. Zwei Schreiben des Vaters, der sich nicht mit dem Verlust seines Jungen abfinden wollte, an offizielle Stellen. Schließlich im September 1948 die endgültige Todesbestätigung samt Sterbeurkunde und der Bitte, von weiteren Nachfragen abzusehen. Schriftliche Zeugnisse eines viel zu kurzen Lebens, das ausgerechnet an einem Heiligen Abend abrupt zu Ende ging.
Dabei hatte Wapplers Soldatenlaufbahn verheißungsvoll angefangen. Seine Rekrutenausbildung machte der junge Mann bis Januar 1943 im "fetten Dänemark", im Herbst 1944 kehrte er noch einmal als Wachsoldat ins schon nicht mehr so behagliche Nachbarland zurück – der Widerstand war erwacht. Dazwischen lag sein Einsatz an der Ostfront. Und auch seine erste Verwundung kurz nach der Feuertaufe im Januar 1944. Auch damals traf ihn ein Granatsplitter, ein glatter Durchschuss im Oberschenkel. Seiner besorgten Mutter antwortete er, auf der Krankenstube sei es "ganz gemütlich".
Mit Bremen machte Hans Wappler im November 1944 nähere Bekanntschaft. Nach seiner Abkommandierung aus Dänemark landete er in der Hindenburg-Kaserne in Huckelriede. "Daß es mir hier großartig gefällt, kann ich mit dem besten Willen nicht behaupten", schrieb er seiner Familie nach Hamburg. "Dienst wie bei den Rekruten", frotzelte er. Die Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung vor den Bombenangriffen empfand er als übertrieben. "Die Bremer geben furchtbar schnell Alarm. Da könnt Ihr in Hamburg von Glück sagen." Vom letzten Aufgebot hatte Wappler keine hohe Meinung. "Wir haben Sonntag eine Vorführung für den Bremer Volkssturm gemacht", schrieb er am 5. Dezember 1944. "Nachher haben die dann mit unseren Gewehren Platzpatronenschießen gemacht. Aber so Zivilisten sind doch ein kläglicher Haufen."
Das klingt fast, als hätte der damals 20-Jährige Gefallen an seiner Militärkarriere gefunden. Doch selbst wenn dem so war – über die Kriegsaussichten machte er sich offenbar keine Illusionen. Von der möglichen Einberufung des Vaters zum Volkssturm versprach er sich keine Stärkung der Kampfkraft. "Oh jee! Na, vielleicht ist bis dahin ja schon der Krieg zu Ende." Nach Siegeszuversicht, nach blindem Glauben an den viel beschworenen "Endsieg" hört sich das nicht an. In die gleiche Richtung weist ein Tadel an die Adresse seiner Mutter. "'Forsche Germanen'", greift er einen Ausspruch aus ihrem Munde auf, "meinst Du nicht auch, daß das ziemlich übertrieben ist?" Um dann etwas vorsichtiger fortzufahren: "Meine Meinung kennst Du doch, und die redet mir jetzt so leicht keiner mehr aus."
In seinen Briefen erweckt Wappler den Eindruck eines selbstbewussten, durchaus kritischen jungen Mannes. Bisweilen verkehren sich die Rollen: Er tröstet und beruhigt seine Mutter, während sie aus ihrem Kummer keinen Hehl macht. Gegen Mitte November 1944 müssen Mutter und Sohn einander zuletzt begegnet sein, das geht aus einer brieflichen Andeutung hervor. Am 8. Dezember wurde seine Einheit zur Neuaufstellung nach Oldenburg verlegt. Den Besuchswunsch der Mutter wiegelte er ab, die Anfahrt sei zu lang, die Zeit zu knapp. "Aber dadurch machst Du es Dir und auch mir viel schwerer, Mama. Du weißt, ich mag nicht gern Abschied nehmen."
Mit der Verlegung zerschlug sich auch die Hoffnung der Eltern, ihren Sohn über Weihnachten zu einem "Arbeitsurlaub" nach Hamburg zu lotsen. Beim "Feuersturm" im Juli 1943 hatte die Familie ihr Heim verloren und war bei Verwandten untergeschlüpft, konnte aber im damals noch dörflichen Volksdorf im Nordosten von Hamburg ein sogenanntes Ley-Haus errichten, ein Behelfsheim für Ausgebombte. Während seines letzten Heimaturlaubs im Herbst 1944 hatte Wappler kräftig mit Hand angelegt, im Dezember stand das Häuschen kurz vor der Fertigstellung. Die Mutter konnte nur schwer verwinden, dass sie ihren Jungen am Heiligen Abend schon wieder nicht in die Arme schließen konnte – zum dritten Mal in Folge.
Zudem beschäftigte die Mutter die Frage, wo ihr Sohn zum Einsatz kommen würde. Rückblickend mag es erstaunlich anmuten, dass sie der Ostfront den Vorzug gab. Die Erklärung: Seit Oktober 1944 hatte sich die Lage vorübergehend stabilisiert, erst am 12. Januar 1945 begann die Schlussoffensive der Roten Armee. Dagegen ging es im Westen weitaus turbulenter zu. Die alliierten Truppen hatten bereits im Oktober 1944 Aachen als erste deutsche Großstadt eingenommen, mit der Ardennenoffensive versuchte die Wehrmacht ab dem 16. Dezember 1944 noch einmal einen Gegenstoß. "Wenn du nur nicht in diese grausame Hölle im Westen kommst", schrieb die Mutter.
Die mütterlichen Hoffnungen erfüllten sich. Am 14. Dezember 1944 meldete sich ihr Sohn aus Danzig mit der Mitteilung, seine Einheit warte auf die Verschiffung nach Kurland. Zu diesem Zeitpunkt war nur noch der Seeweg offen, die deutschen Truppen befanden sich seit Oktober im "Kurland-Kessel". In den ersten beiden "Kurland-Schlachten" hatten sie den sowjetischen Angriffen widerstanden. "Keine Angst, Mama, es wird nicht so schlimm", schrieb Hans Wappler. Vier Tage später dann der vorletzte Brief schon aus dem riesigen Kessel – seekrank wäre er fast geworden, teilte er mit. Sein letztes Schreiben trägt das Datum des 20. Dezember 1944. Allem Anschein nach wurde ihm nun doch ein wenig mulmig zumute. Die meisten seiner Kameraden seien schon wieder verwundet. "Aber leider sind auch viele von den Besten gefallen."
Nur einen Tag später brach die dritte Kurland-Schlacht mit einem sowjetischen Trommelfeuer auf 35 Kilometern Breite los. Was anschließend geschah, berichtete ein Kamerad der Mutter im November 1949. "Wir konnten am 22. Dezember noch fliehen und der Hölle entrinnen, und sind dann beide die ganze Nacht umhergeirrt, bis wir morgens um 5 Uhr unsere Kompanie wiedergefunden haben." Sie seien darauf bedacht gewesen, ihr Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. "Am 24. Dezember marschierten wir zum Angriff." Wappler sei sein zweiter MG-Schütze gewesen. "Doch in dem Wald, wo wir eindrangen, war die Hölle."
Dass der Granatsplitter den 20-Jährigen sofort tötete, wurde von mehreren Seiten bestätigt. Unter anderem von einem Freund des Bruders, der im Februar 1945 aus dem Kessel berichtete und sich dabei auf die Angaben von unmittelbar Beteiligten stützte. Seine Leiche konnte wegen eines russischen Gegenangriffs nie geborgen werden. Die beiden Elternteile überlebten ihren Sohn um Jahrzehnte, sie starben hochbetagt 1989 und 1992. Der Bruder Alfred Wappler folgte ihnen 2016 im Alter von 92 Jahren.