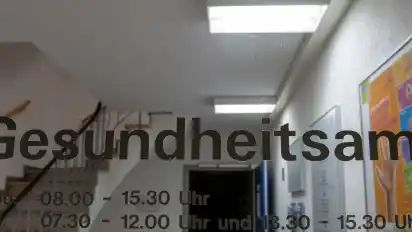Die Gesundheitsämter sind in der Corona-Pandemie der Dreh- und Angelpunkt. Jetzt soll der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) – also die bundesweit 375 Gesundheitsämter – für die kommenden fünf Jahre vier Milliarden Euro bekommen. Nach Bremen fließen 31 Millionen Euro. Was sind die größten Baustellen?
Ansgar Gerhardus: Die unzureichende finanzielle, personelle und technische Ausstattung begleitet den öffentlichen Gesundheitsdienst seit Jahrzehnten. Und die Baustellen werden immer größer. Tatsächlich hat sich die personelle Situation sogar noch verschlechtert. Zwischen den Jahren 1990 und 2000 – für die Zeit danach gibt es kein gutes Zahlenmaterial mehr – ist etwa die Zahl der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst bundesweit von 3500 auf 2500 zurückgegangen. Die Finanzierung wurde ebenfalls zurückgefahren. Auch im Bremer Gesundheitsamt muss einiges passieren, das ist extrem überfällig.
Also mehr Stellen im ärztlichen Bereich schaffen...
Nicht nur. Durch die Finanzspritze gibt es jetzt die Chance, den öffentlichen Gesundheitsdienst breiter und zeitgemäßer in seiner Struktur aufzustellen, also fit für die Zukunft zu machen. Natürlich geht es auch um Arztstellen. Die Anforderungen an den öffentlichen Gesundheitsdienst haben sich aber sehr verändert. Das hat auch mit gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen zu tun, und diese neuen Aufgaben müssen sich in der Personalstruktur widerspiegeln. Es geht nicht nur um die Zahl der Personen, sondern um die Art der Qualifikation, das ist extrem vernachlässigt worden.

Ansgar Gerhardus, Professor an der Universität Bremen.
Was meinen sie damit konkret? Welches Personal fehlt?
Seit mehr als 15 Jahren gibt es Public-Health-Studiengänge mit Bachelor- und Master-Abschluss – Public Health bedeutet übersetzt öffentliche Gesundheit. Dort werden Spezialistinnen und Spezialisten genau für diesen Bereich ausgebildet. Sie sind bislang aber sehr unterrepräsentiert im öffentlichen Gesundheitsdienst. 2016 wurden alle Gesundheitsämter in Deutschland dazu befragt, danach kam auf etwa 200 Mitarbeiter ein einziger nicht-ärztlicher beziehungsweise eine nicht-ärztliche Public-Health-Spezialistin.
Was können diese Spezialisten mit Uni-Abschluss, was sind ihre Einsatzgebiete?
Ein zentrales Fach im Studium ist die Epidemiologie, die das Neuauftreten und die Verbreitung von Krankheiten untersucht. Es geht aber auch um Gesundheitsmanagement, Kommunikation, Koordination, Planung. In der Pandemie hätte man sie zum Beispiel gebraucht, um die Kontaktnachverfolgung und andere Einsätze etwa von Helferinnen und Helfern zu planen, zu koordinieren und mit der Bevölkerung zu kommunizieren.
Gibt es denn überhaupt genug Public-Health-Fachkräfte? Die Gesundheitsämter haben ja schon Probleme, Arztstellen zu besetzen.
Die Universität Bremen ist einer der größten und renommiertesten Standorte in Deutschland für die Ausbildung. Jedes Jahr machen insgesamt weit über 100 Studierende ihren Bachelor- und Masterabschluss in Public Health. Die Absolventinnen und Absolventen haben häufig schon sehr attraktive Angebote, bevor sie mit dem Studium fertig sind – zum Beispiel auch von Krankenkassen. Sie werden uns regelrecht aus der Hand gerissen.
Und von den Gesundheitsämtern eher nicht?
Die Angebote kommen teilweise auch aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, aber eben nicht aus Bremen, sondern von anderen Standorten, die da schon weiter sind. Was diese Spezialisten mit Uni-Abschluss betrifft, ist das Bremer Gesundheitsamt noch schlecht aufgestellt. Mit dem ÖGD-Pakt hätte man jetzt die große Chance, das zu ändern. Aber die Ausschreibungen gehen wieder in eine andere Richtung. Wenn man sieht, was jetzt in der Pandemie und darüber hinaus gebraucht wird, gehören sie definitiv zum Gesundheitsamt der Zukunft. Es werden auch Stellen für Präventionsfachkräfte ausgeschrieben, das ist sehr wichtig, sie gehen etwa in die Stadtteile und an Schulen. Meist sind das aber befristete Stellen.
Im Moment bestimmt die Pandemie das Geschäft, wie lange noch, ist unklar. Was sind denn in dem von Ihnen beschriebenen Gesundheitsamt der Zukunft die Schwerpunkte?
Jedes Gesundheitsamt in Deutschland hat vier Kernaufgaben, die es erfüllen muss. Das sind Infektionsschutz, Hygiene, Schuleingangsuntersuchungen und Begutachtungen, also der amtsärztliche Dienst. Dafür braucht man selbstverständlich weiterhin Ärztinnen und Ärzte. Im ÖGD-Pakt sind aber weitere Schwerpunkte definiert, Gesundheitsförderung und Prävention etwa. Das gibt es schon in Bremen, wird aber mehr. Die Ämter sollen zudem eine stärkere koordinative Rolle bei Gesundheitsthemen auf kommunaler Ebene einnehmen, auch gemeinsam mit anderen Initiativen. Weiterer Fokus ist die gesundheitliche Versorgung von benachteiligten Gruppen, da hat Bremen seit vielen Jahren etwa eine Sprechstunde für Menschen ohne Krankenversicherung. All diese Bereiche sollen aber stärker ausgebaut werden. Der ÖGD soll zudem an allen Planungen der Politik beteiligt werden, bei denen Gesundheit eine Rolle spielt, Verkehrsthemen etwa oder auch der Klimawandel. Letzter Punkt ist die Wissenschaftlichkeit.
Was ist damit gemeint?
Die größeren Gesundheitsämter müssen Leute haben, die wissenschaftliche Studien auswerten und aufbereiten können - es geht darum, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis kommen. Die Ämter müssen nicht selbst Forschung betreiben, sondern im besten Fall an universitäre Einrichtungen angebunden sein. In den Niederlanden ist das Standard, in Deutschland gibt es vereinzelt solche Kooperationen, in Tübingen etwa. In Bremen findet das eher punktuell auf Projektebene statt. Das ist paradox, weil es an der Uni den großen Public-Health-Bereich gibt. Um dies auszubauen, braucht man mindestens eine Person im Gesundheitsamt als Schnittstelle. Es geht um feste Ansprechpartner, das muss systematisiert werden. Und es können auch eigenen Studien und Befragungen mit universitärer Unterstützung gemacht werden.
Vieles hängt aber auch an der technischen Ausstattung, sprich: Digitalisierung. In der Pandemie haben wir erfahren, dass immer noch viel gefaxt wird.
Da gibt es einen riesigen Nachholbedarf. 2013 wurde das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem, Demis, eingeführt, um die digitale Kommunikation im öffentlichen Gesundheitsdienst zu modernisieren – also von der kommunalen auf die nationale Ebene etwa zum Robert Koch-Institut. Das war leider bis 2020 noch nicht richtig funktionsfähig. Die personelle und digitale Ausstattung sind sicherlich die größten Baustellen.
Das Gespräch führte Sabine Doll.