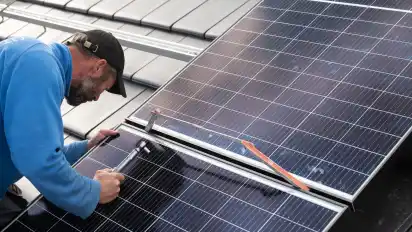Die rot-grün-rote Koalition hat ihr Klimaschutzpaket auf den parlamentarischen Weg gebracht. Die Bürgerschaft beschloss am Mittwoch in erster Lesung einen Nachtragshaushalt, der Kreditermächtigungen im Volumen von 2,5 Milliarden Euro für diesen Zweck vorsieht. Vorrangig sollen Projekte angegangen werden, die einen besonders großen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten: Umstellung der Wärmeversorgung, umweltfreundliche Mobilität, energetische Sanierung öffentlicher Gebäude und klimaneutrale Produktion. Weitere 500 Millionen Euro sind für Maßnahmen vorgesehen, mit denen der Senat die Auswirkungen des massiven Energiepreisanstiegs abpuffern will. Bremens Schuldenstand – gemessen an der Einwohnerzahl ohnehin der höchste unter den Bundesländern – würde damit abermals deutlich anwachsen.
Mit dem Votum der Koalitionsmehrheit geht das Finanzpaket nun zunächst in die Deputationen und Bürgerschaftsausschüsse, wo über einzelne Aspekte des Milliardenpakets diskutiert werden wird. Mit einer endgültigen Beschlussfassung ist für das Frühjahr zu rechnen. In der ersten Lesung gab es durchaus Gemeinsamkeiten – alle Fraktionen bekannten sich zum Ziel der Klimaneutralität. Welcher Weg dahin der sinnvollere ist, darüber wurde engagiert gestritten.
Finanzsenator Dietmar Strehl:
Der Grünen-Politiker erläuterte den Abgeordneten, wie er sich den verfassungskonformen Weg zur Aufnahme der Klima-Schulden vorstellt. Denn eigentlich müssen Bund und Länder ihre Haushalte ohne neue Schulden bestreiten. Es sei denn, das jeweilige Parlament ruft eine außergewöhnliche Notlage aus, wie das etwa während der Corona-Pandemie der Fall war. So stellt es sich Strehl auch diesmal vor. Die Bürgerschaft würde die drohende Klimakatastrophe als Begründung für die Aufnahme von Krediten geltend machen – wobei der Finanzsenator in diesem Zusammenhang auf einen feinen, aber bedeutenden Begriffsunterschied aufmerksam machte. Es geht vorerst nicht um Kredite, sondern um Kreditermächtigungen. Strehl pumpt sich also nicht auf einen Schlag mehrere Milliarden am Kapitalmarkt, sondern erst dann Teilbeträge, wenn der konkrete Finanzierungsbedarf eintritt, also sobald erste Klimaschutzprojekte zur Umsetzung anstehen. Für das laufende Jahr veranschlagt er dafür 235 Millionen Euro.
Jens Eckhoff (CDU):
Der Haushaltspolitiker der Union knüpfte genau an diesem Punkt an. Wenn 2023 tatsächlich lediglich 235 Millionen Euro mobilisiert werden müssten, brauche es dazu keinen Nachtragshaushalt. Es gebe Reserven durch vorausgesagte Steuermehreinnahmen und bestehende Kreditermächtigungen. Eckhoff prophezeite zudem: Der Senat wird nicht in der Lage sein, die besagten 235 Millionen Euro tatsächlich auszugeben. Das habe sich in den letzten Jahren gezeigt, als die Landesregierung jeweils kleine Finanztöpfe für Klimaschutzprojekte in die Haushalte eingebaut hatte. So seien 2020 von eingeplanten zehn Millionen Euro genau null Euro abgeflossen, 2021 von 20 Millionen nur 13 Millionen. Die Kommunal- und Landesverwaltung, so Eckhoffs Schlussfolgerung, sei gegenwärtig also gar fähig, Projekte in dreistelliger Millionenhöhe zu stemmen. Insgesamt gebe es erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Nachtragshaushaltes. "Wir werden deshalb eine Klage prüfen", kündigte Eckhoff an.
Carsten Sieling (SPD):
Das geplante Milliardenpaket sei nicht nur gut für das Klima, sondern auch für die Wirtschaft des kleinsten Bundeslandes. Darauf machte der Haushaltspolitiker Carsten Sieling aufmerksam. Energetische Sanierungen, neue Wärmenetze, die umweltgerechte Produktionsumstellung bei den Stahlwerken – all das schaffe und sichere Arbeitsplätze. Allerdings sei es nicht damit getan, das notwendige Geld zur Verfügung zu stellen. Wichtig sei auch, für genügend Fachkräfte zu sorgen, die all die ehrgeizigen Projekte Realität werden lassen. Sieling lobte deshalb die Fachkräftestrategie, auf die sich der Senat am Dienstag verständigt hatte.
Björn Fecker (Grüne):
Die geplante zusätzliche Verschuldung schränke wegen der 2028 einsetzenden Rückzahlungen künftige finanzielle Spielräume ein und belaste damit die nächste Generation, räumte der Grünen-Fraktionschef ein. Jetzt nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen, werde aber mit Sicherheit noch teurer, gab er zu bedenken. Der CDU warf er vor, keine brauchbaren Vorschläge zur Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen zu machen. Dabei hätten die Christdemokraten den Handlungsbedarf in der Klima-Enquetekommission der Bürgerschaft eindeutig bejaht.
Sofia Leonidakis (Linke):
Die Linken-Fraktionschefin riet der CDU, sich bei der Verbesserung der Bremer CO2-Bilanz konkret nützlich zu machen. So warteten die Stahlwerke seit zwei Jahren darauf, dass die EU-Kommission in Brüssel einen Förderantrag zur klimafreundlichen Produktionsumstellung bewilligt. Die Christdemokraten könnten doch bei ihrer Parteifreundin und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "ein gutes Wort einlegen, statt Schuldzuweisungen in Richtung Senat vorzunehmen", sagte Leonidakis. Die Linken-Politikerin warb außerdem für die völlige Abschaffung der Schuldenbremse in Grundgesetz und Landesverfassung. Sinnvoller sei es, "durch gerechte Steuern Einnahmen zu erhöhen".
Thore Schäck (FDP):
Besondere Herausforderungen könnten durchaus eine Verschuldung rechtfertigen, sagte FDP-Finanzsprecher Thore Schäck. In Bremen sei eine ständig wachsende Neuverschuldung jedoch die Regel, nicht die Ausnahme, hielt er insbesondere der SPD vor. Er warnte davor, den finanziellen Bewegungsspielraum des Stadtstaates durch Zins- und Tilgungsverpflichtungen immer weiter einzuschränken. Dieser Trend habe jetzt schon spürbare Auswirkungen. So sei der Anteil der Investitionen im Haushalt seit 2000 von 20 auf zehn Prozent gefallen. Schäck rief den Senat auf, zumindest einen Teil der geplanten Ausgaben für den Klimaschutz durch Einsparungen an anderer Stelle zu finanzieren.