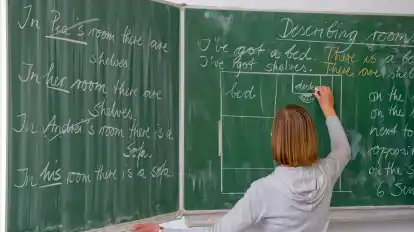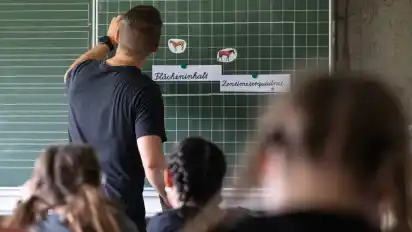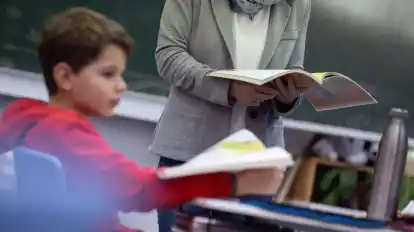Im Streit um die Erfassung der Lehrerarbeitszeit stehen die Zeichen auf Sturm. Laut Personalrat Schulen hat Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) den Spruch der Einigungsstelle abgelehnt und den Senat eingeschaltet. Die Bildungsbehörde bestätigt den Vorgang. Man werde den Senat bitten, "den Beschluss der Einigungsstelle aufzuheben und durch einen Senatsbeschluss zu ersetzen", sagt Ressortsprecherin Patricia Brandt. Derzeit bereite die Behörde den Beschluss vor, mit einer Entscheidung des Senats rechnet sie in den nächsten Wochen. Damit zeichnet sich weiterhin keine Lösung des Dauerkonflikts ab. Die Arbeitnehmervertreter dringen darauf, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur systematischen Arbeitszeiterfassung auch bei Lehrkräften umzusetzen, die Stadtgemeinde als Arbeitgeber setzt auf eine gemeinsame Regelung der Länder.
Unterdessen sind jetzt erstmals Details zum Spruch der Einigungsstelle publik geworden. Wie die Bildungsgewerkschaft GEW auf Nachfrage mitteilt, sah der Beschluss der Einigungsstelle vor, mit der systematischen Erfassung der Lehrerarbeitszeit im kommenden Jahr zu beginnen. An mehreren Pilotschulen sollte die Arbeitszeiterfassung am 1. Februar 2026 starten, die flächendeckende Einführung war für den 1. August 2026 vorgesehen. Mit dieser Terminierung hat der Vorsitzende der Einigungsstelle einen Kompromissvorschlag unterbreitet. Wäre es nach dem Initiativantrag des Personalrats gegangen, hätte die Arbeitszeiterfassung in den Pilotschulen und allen anderen Bildungseinrichtungen genau ein Jahr früher anfangen sollen, würde in den Pilotschulen also schon laufen. Nach Ablehnung des Kompromissvorschlags greift laut GEW jetzt wieder die Ursprungsvariante – die flächendeckende Arbeitszeiterfassung müsste in diesem Sommer starten.
Unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Nach Ansicht des Personalrats würde der Senat bei einem Machtwort seine Kompetenzen überschreiten. "Es handelt sich um eine soziale Maßnahme, die nicht unter den sogenannten Senatsvorbehalt fällt", sagt der Vorsitzende des Personalrats, Jörn Lütjens. Weil mit der Arbeitszeiterfassung höchstrichterliche Rechtsprechung umgesetzt werde, könne sich der Senat nicht auf sein Letztentscheidungsrecht über Beschlüsse von Einigungsstellen berufen. Dem widerspricht die Bildungsbehörde. "Der Beschluss der Einigungsstelle hat keinen Bestand, wenn der Senat einen anderen Beschluss fasst", sagt Brandt.
Laut Lütjens wäre es ein "handfester Skandal", wenn der Senat weiter gegen geltendes Recht zum Gesundheitsschutz seiner Beschäftigten verstößt. Deshalb habe der Personalrat am Montag das Verwaltungsgericht angerufen. Wie berichtet, hatte kürzlich bereits das Institut für interdisziplinäre Schulforschung (ISF) Überlegungen angestellt, Aulepp wegen Rechtsbeugung zu belangen. Im Falle des Initiativantrags sieht ISF-Sprecher Helmut Zachau allerdings die Bildungsbehörde rechtlich auf der sicheren Seite. Die Senatorin könne den Beschluss der Einigungsstelle kassieren lassen, weil überwiegend Beamte betroffen seien. "Da hat der Senat das Letztentscheidungsrecht."
Die Bildungsbehörde will vor einer Erfassung der Lehrerarbeitszeit erst einmal die Rahmenbedingungen und möglichen Folgen für den Schulbetrieb klären. Zunächst müsse der Bund ein entsprechendes Arbeitszeitgesetz auf den Weg bringen. "Das hat in der letzten Legislatur nicht geklappt, mal sehen, ob eine neue Bundesregierung das schafft", sagt Ressortsprecherin Brandt. Schon aus diesem Grund wolle Bremen "nicht als kleinstes Bundesland voranpreschen". Bremen könne sich "keinen Schnellschuss leisten". Man sei in der Verantwortung gegenüber Schülern und Eltern. Die Sicherstellung einer ausreichenden Unterrichtsversorgung und die bestmögliche Vorbereitung der Schüler auf das Berufsleben oder Studium habe Priorität. Dennoch werde Bremen in der Kultusministerkonferenz (KMK) weiter auf eine Lösung drängen, um mit einem Pilotmodell zur Arbeitszeiterfassung zu starten.
Aus Sicht von GEW-Landesvorstandssprecherin Elke Suhr kann es am Grundproblem keinen Zweifel geben. Zahlreiche Studien belegten, dass der Durchschnitt der Lehrkräfte zu viel arbeite und diese Mehrarbeit nicht berücksichtigt werde. Deshalb hätten alle Bundesländer große Vorbehalte gegen die Erfassung der Arbeitszeit. Denn: "Jedes Bundesland, das sich in dieser Frage bewegt, steht unter bundesweiter Beobachtung." Suhr rechnet mit einem Dominoeffekt, wenn das erste Bundesland seinen Widerstand aufgibt. "Dann ist es offen, dann müssen die anderen Länder folgen." Mit anderen Worten: Ein Präzedenzfall könnte Signalwirkung haben. Ein im Februar 2024 angekündigtes Pilotprojekt zur Erfassung der Lehrerarbeitszeit hatte die Behörde wieder gestrichen.
Die Herausforderungen, die mit einer Arbeitszeiterfassung auf die Bildungsbehörde zukommen würden, leugnet Suhr nicht. "Es müsste eigentlich wahnsinnig viel Personal neu eingestellt werden", sagt sie. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie sie einräumt. Gleichwohl sieht Suhr die Behörde damit nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. "Wir müssen irgendetwas tun, um die Arbeitsbelastung zu reduzieren", sagt sie. Zum Beispiel könne man die Bildungspläne entschlacken und die Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben befreien. "Es gibt viele Sachen, die man tun kann, um eine zeitliche Entlastung herbeizuführen."