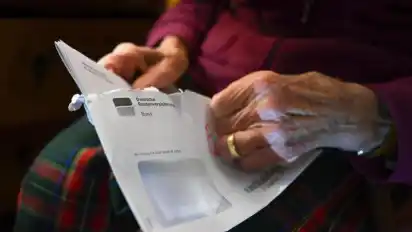- Wie kann die Rente auch in Zukunft gesichert werden?
- Das Gesundheitswesen muss effektiver werden – aber wie?
- Ist Hartz IV überhaupt noch zeitgemäß?
- Wie lassen sich die Defizite in der Pflege beheben?
- Welche Konzepte helfen gegen die Wohnungsnot?
Am 26. September wählt Deutschland den 20. Deutschen Bundestag. Eine Wahl, die Spannung verspricht und gleichzeitig eine Zäsur ist: Kanzlerin Angela Merkel steht nicht zur Wiederwahl. Wir möchten Ihnen den Überblick erleichtern: Beginnend an diesem Sonntag folgen bis zum 12. September, jeweils am Sonntag, sieben Übersichten zu den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien. Dieser Teil beschäftigt sich mit Sozialpolitik und Fragen rund um Hartz IV, Pflege, Rente, Gesundheit und Wohnraum.
Wie kann die Rente auch in Zukunft gesichert werden?
CDU/CSU: "Die beste Rentenpolitik ist eine gute Wirtschaftspolitik", betonen CDU und CSU. Die Alterssicherung soll aus drei Säulen bestehen: der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersvorsorge und einer privaten Vorsorge. Mit Blick auf Geringverdiener will die Union ein Konzept einer "betrieblichen Altersvorsorge für alle" entwickeln. Für die Privatvorsorge soll es einen "Neustart" geben – mit einer attraktiven und unbürokratischen Förderung durch den Staat. Es gibt keine Festlegung auf eine weitere Anhebung des Rentenalters.
SPD: Die SPD will auch Selbstständige, Freiberufler und Beamte in die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung einbeziehen. Das Rentenniveau soll dauerhaft bei mindestens 48 Prozent liegen. Die Partei lehnt eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 67 ab. Auch an der abschlagsfreien Rente ab 63 soll nicht gerüttelt werden. Es soll ein attraktives Angebot für die Privatvorsorge geben, das von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Zuschüsse bleiben auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränkt.
Grüne: Die Grünen räumen einer langfristigen Sicherung des Rentenniveaus bei mindestens 48 Prozent eine "hohe Priorität" ein. Am Eintrittsalter von 67 Jahren soll festgehalten werden, aber es soll mehr Möglichkeiten geben, früher in Rente zu gehen. Die Riester-Rente hat sich als "Fehlschlag" erwiesen und wird abgeschafft, ein öffentlich verwalteter "Bürgerfonds" soll sie ersetzen. Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, den Mitarbeitern eine betriebliche Altersvorsorge anzubieten. Bei Bedarf werden die Steuerzuschüsse für die Rente erhöht.
FDP: Die FDP setzt mit ihren Rentenplänen auf Flexibilität. Mit einem individuellen Baukastenprinzip können gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge frei miteinander kombiniert werden. Wer das Alter von 60 erreicht hat, soll selbst entscheiden können, wann der Ruhestand beginnt. Dabei sollen Zuverdienstgrenzen abgeschafft werden und Teilrenten möglich sein. Bei der privaten Vorsorge plädiert die FDP für die Einführung einer Aktienrente. Rund zwei Prozent des Beitrags für die gesetzliche Versicherung sollen in einen Fonds fließen.
Linke: "Als Sofortmaßnahme heben wir das Rentenniveau auf 53 Prozent an", verspricht die Linke. Sie will das Renteneintrittsalter von 67 auf 65 Jahre senken. Ab 40 Arbeitsjahren soll eine Verrentung bereits ab einem Alter von 60 Jahren möglich sein. Die Riester-Vorsorge wird abgeschafft, im Gegenzug will die Linke für alle einen Zuschuss zur gesetzlichen Rente zahlen. Statt Grundrente soll es eine "solidarische Mindestrente" in Höhe von 1200 Euro geben. Selbstständige, Beamte und Freiberufler werden in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen.
AfD: Die AfD hat sich nicht auf ein bestimmtes Rentenniveau festgelegt. Der Eintritt in die Rente soll erheblich flexibler werden: Wer länger einbezahlt hat, bekommt entsprechend mehr ausbezahlt. Die Partei will einen höheren Steuerzuschuss zur Finanzierung der Rente. Er soll durch Streichungen von "ideologischen Politikmaßnahmen" wie Migrations-, Klima- und Europa-Politik finanziert werden. Eine Besonderheit in den Plänen: Eltern sollen pro Kind 20.000 Euro an Beiträgen erstattet bekommen. Zur privaten Vorsorge macht die AfD keine Angaben.
Das Gesundheitswesen muss effektiver werden – aber wie?
CDU/CSU: Beim Thema Gesundheit stellt die Union die Digitalisierung in den Mittelpunkt und will die Bürokratie reduzieren. Sie schreibt im Wahlprogramm von einer "eHealth-Roadmap", die einen digitalen Plan für die Gesundheitsversorgung bis 2030 vorgeben soll. Sie setzt auf das Zusammenspiel von gesetzlichen und privaten Krankenkassen und lehnt eine Einheitsversicherung ab, genauso eine europäische Gesundheitsversicherung. Für Gesundheitsberufe will die Union eine allgemeine Ausbildungsvergütung einführen und das Schulgeld abschaffen.
SPD: Die SPD spricht von einer notwendigen Reform des Gesundheitssystems. Mit einer "Bürgerversicherung" will sie mittels einer solidarischen Finanzierung einen gleich guten Zugang zur medizinischen Versorgung für alle einführen. Die Sozialdemokraten wollen außerdem die Kommerzialisierung im Gesundheitswesen beenden. Gewinne aus ihrer "Solidargemeinschaft" sollen demnach wieder in das Gesundheitssystem zurückfließen. Zudem wollen sie die Kinder- und Jugendmedizin neu strukturieren und hier etwa die psychotherapeutische Versorgung stärken.
Grüne: Die Grünen schlagen vor, ein "Bundesinstitut für Gesundheit" zu erschaffen. Es soll Gesundheitsziele entwickeln und zur "Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems berichten". Sie setzen sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Vergütung von Therapieberufen ein und wollen das Schulgeld in den Ausbildungen abschaffen. Sie fordern "eine solidarisch finanzierte Bürger*innenversicherung, in der jede*r unabhängig vom Einkommen die Versorgung bekommt, die er oder sie braucht". Die Beiträge sollen abhängig vom Einkommen erhoben werden.
FDP: Die Liberalen wollen eine digitale Vernetzung zwischen allen Akteuren im Gesundheitsbereich und den Patienten vorantreiben. Sie wollen die Assistenz von Robotern und digitale Infrastrukturen in Krankenhäusern fördern. Um das Gesundheitssystem zu entbürokratisieren, will die FDP Bürokratie- und Berichtspflichten bepreisen: Wer diese anfordert, soll sie auch bezahlen. Die Partei spricht sich zudem für mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen aus. Hier will sie den gesetzlichen Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ausweiten.
Linke: "Die momentane Finanzierung der Krankenhäuser über das System der sogenannten Fallpauschalen schafft falsche Anreize: Diagnosen, die sich lohnen, werden öfter gestellt", schreibt die Linke. Sie will die Fallpauschale abschaffen, die Betriebskosten sollen von den Krankenkassen refinanziert werden. Zudem fordert sie ein Gewinnverbot für Krankenhäuser. Ein weiterer Vorschlag der Partei ist eine solidarische Gesundheitsvollversicherung: Alle zahlen ein, für Menschen mit einem Monatseinkommen unter 6300 Euro sinken die Beiträge in absoluten Zahlen.
AfD: Die AfD widmet sich beim Thema Gesundheit zu einem großen Teil der Corona-Pandemie. Sie spricht sich klar für ein Ende der "unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen" aus. "Überwachungsmaßnahmen" wie eine verpflichtende Impfung, Immunitätsausweise oder Corona-Apps lehnt die Partei ab. Für Krankenhäuser will die AfD ein Individualbudget einführen, die Höhe berechnet sich etwa aus dem Bedarf der Bevölkerung oder der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Klinik. Die AfD setzt sich zudem für eine bessere medizinische Versorgung auf dem Land ein.
Ist Hartz IV überhaupt noch zeitgemäß?
CDU/CSU: Die Union stellt klar, dass es mit ihr kein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird. CDU und CSU setzen vor allem auf das "Fordern und Fördern", wie sie mehrfach betonen: Sie versprechen, allen Arbeitssuchenden ein Angebot für eine Aus- oder Weiterbildung zu machen. Die Union hält an den Hartz-IV-Sanktionen fest, will die Bedingungen aber verbessern: Die Anrechnung von Einkommen im Sozialgesetzbuch II soll neu gestaltet werden – wie genau, erwähnt sie nicht. Sie will den Verwaltungsaufwand und die Zahl der Gerichtsverfahren reduzieren.
SPD: Im Wahlprogramm der SPD taucht das der von der Partei geprägte Begriff Hartz IV gar nicht auf. Stattdessen schreiben die Sozialdemokraten von der Grundsicherung, die sie überarbeiten und zu einem Bürgergeld entwickeln wollen. Dieses soll digital und unkompliziert zugänglich sein. "Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untragbaren Last werden", heißt es. Weitere Worte zur Höhe des Bürgergelds verliert die SPD nicht, nur dass sie die Kriterien für den Regelsatz weiterentwickeln will.
Grüne: Die Grünen sprechen sich dafür aus, Hartz IV durch eine "Garantiesicherung" zu ersetzen. "Das soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden", heißt es. Den Regelsatz will die Partei um mindestens 50 Euro anheben. Hinzuverdienste will sie so anrechnen, dass zusätzliche Arbeit zu einem spürbar höheren Einkommen führt. Sanktionen wie bei Hartz IV sollen bei der "Garantiesicherung" wegfallen. Die Grünen begrüßen Modellprojekte zum bedingungslosen Grundeinkommen.
FDP: Die FDP spricht sich für ein "liberales Bürgergeld" aus. Dieses soll Hartz IV, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld an einer Stelle zusammenfassen. Selbst verdientes Einkommen soll geringer als bisher angerechnet werden. "Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdewahrender, leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden", schreiben die Liberalen im Wahlprogramm. Sie fordern einen einheitlichen Satz für alle erwachsenen Leistungsbezieher, unabhängig vom familiären Status.
Linke: In ihrem Wahlprogramm-Entwurf schreibt die Linke: „Die Zeit für Hartz IV ist abgelaufen.“ Stattdessen will sie eine „Mindestsicherung“ von 1200 Euro einführen, die sanktionsfrei ist und nicht gekürzt wird. Das Arbeitslosengeld I soll nach Ansicht der Linken länger gezahlt und die Ansprüche darauf schneller erworben werden. Zusätzlich verspricht die Linke ein „Arbeitslosengeld Plus“: Das soll verhindern, dass Erwerbslose nach dem Bezug von ALG I direkt bei Hartz IV landen. Die Höhe entspricht 58 Prozent des Nettogehalts plus Inflationsausgleich.
AfD: Die AfD will als Alternative zu Hartz IV eine "aktivierende Grundsicherung" einführen. Erzieltes Einkommen soll demnach nicht vollständig mit den Leistungen verrechnet werden, Erwerbstätigen soll ein spürbarer Anteil des eigenen Verdienstes bleiben. Ein Anspruch auf Leistungen soll zudem nur für jene EU-Ausländer bestehen, die "unter Aufnahme einer existenzsichernden Tätigkeit" nach Deutschland einwandern. Außerdem fordert die Partei, Sozialleistungen nur noch auf inländische Konten auszuzahlen.
Wie lassen sich die Defizite in der Pflege beheben?
CDU/CSU: Die Arbeitsbedingungen in Berufen der Alten- und Krankenpflege will die Union attraktiver machen und hebt eine "verlässliche Gestaltung der Dienstpläne" hervor. CDU und CSU wollen die Vielfalt der Träger stärken und erhoffen sich vom Wettbewerb bessere Angebote. Auch hier konzentriert sich die Union auf Digitalisierung, mit der sie Personal entlasten will und durch Assistenz- und Warnsysteme die Bedürftigen unterstützen möchte. 500 Millionen Euro will sie für eine "Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege" bereitstellen.
SPD: Die SPD spricht sich für gute Arbeitsbedingungen und "vernünftige Löhne" im Bereich Pflege aus. Sie will die Ausbildung kostenfrei und mit einer Vergütung gestalten. "Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung für die Verbesserung von Diagnosen und für die flächendeckende gesundheitliche Versorgung entschlossener nutzen", verspricht die SPD, betont aber, dass Digitalisierung Pflegepersonal nicht ersetzen kann. Für erwerbstätige pflegende Angehörige fordert sie ab 15 Monate Anspruch auf Lohnersatz ab Pflegegrad 2.
Grüne: In der Pflege wollen sich die Grünen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal einsetzen. Zum Beispiel schlagen sie andere Arbeitszeitmodelle vor – etwa eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn. Auch sprechen sich die Grünen für höhere Löhne aus. Sie wollen Studiengänge im Pflegebereich "finanziell und strukturell" fördern. Menschen, die sich um Bedürftige kümmern, sollen mit dem Konzept "Pflege-Zeit Plus" unterstützt werden: Damit sollen Löhne ersetzt werden, wenn pflegende Erwerbstätige im Beruf drei Monate vollständig ausfallen.
FDP: Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege sind auch den Liberalen wichtig. "Darum wollen wir von der Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung bis hin zu mehr Karrierechancen dafür sorgen, dass der Beruf wieder attraktiver wird." Sie fordern eine Reform der Ausbildung mit mehr digitalen Inhalten und einer Ausweitung der Pflegewissenschaften an den Hochschulen. Mit der FDP soll es außerdem ein "liberales Pflegebudget" geben, Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade sollen in ein monatliches Budget übergehen.
Linke: Beim Pflegenotstand wird die Linke sehr konkret: Sie fordert jeweils 100.000 Pflegekräfte mehr in Krankenhäusern und Pflegeheimen, außerdem 500 Euro mehr Grundgehalt. Der Vorsorgefonds soll nach Idee der Linken in einen Pflegepersonalfonds umgewandelt werden: Medizinische Behandlungspflege, auch in stationären Einrichtungen, muss von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden. Die Partei fordert ein Fachkräfteniveau von mindestens 50 Prozent in Pflegeeinrichtungen, das bundesweit verbindlich umgesetzt werden soll.
AfD: Die AfD fordert eine "Beendigung des Pflegenotstands". Sie will eine "leistungsgerechte, angemessene" Bezahlung über einen Flächentarifvertrag mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen einführen. Eine bundeseinheitliche gesetzliche Personaluntergrenze soll dem Pflegenotstand entgegenwirken. Die AfD zieht "nicht nur aus sozialen, sondern auch aus finanziellen Gründen" eine häusliche Pflege vor. Außerdem schlägt die Partei vor, die Pflegeversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung zusammenzulegen.
Welche Konzepte helfen gegen die Wohnungsnot?
CDU/CDU: Bauen, bauen, bauen, so lautet die Devise von CDU und CSU. Ausreichender Wohnraum sei der beste Mieterschutz und sorge auch für stabile Mieten. Bis 2025 sollen mehr als 1,5 Millionen neue Wohnungen in Deutschland entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen für Wohnungsbaugesellschaften und Bauherren bestehende Steuererleichterungen verlängert und die Bürokratie abgebaut werden. Die Union lehnt Mietpreisbremse und Mietmoratorium strikt ab. Für Geringverdiener will sie den sozialen Wohnungsbau fördern und das Wohngeld regelmäßig anpassen.
SPD: Die Sozialdemokraten setzen vor allem darauf, den Anstieg von Bestandsmieten zu verhindern. Dafür wollen sie für Regionen mit angespannter Wohnungslage ein befristetes Moratorium einführen. Mieten dürfen dann nur in Höhe der Inflationsrate steigen. Die Partei will die bestehende Mietpreisbremse unbefristet verlängern und verschärfen. Jährlich sollen rund 100.000 Sozialwohnungen gebaut werden. Als neues Segment will die SPD einen gemeinnützigen Wohnungsmarkt schaffen.
Grüne: Bundesweit wollen die Grünen gesetzliche Mietobergrenzen für bestehende Wohnungen ermöglichen, die Mietpreisbremse soll entfristet und "deutlich verschärft" werden. Reguläre Erhöhungen sollen im Rahmen des Mietspiegels auf 2,5 Prozent im Jahr begrenzt sein. Bei Modernisierungen werden die umgelegten Kosten auf 1,5 Euro pro Quadratmeter beschränkt. In den kommenden Jahren soll der Bestand an Sozialwohnungen um eine Million erhöht werden. Die Grünen wollen – ähnlich wie die SPD – ein "gemeinwohlorientiertes" Wohnungsmarkt-Segment etablieren.
FDP: Die FDP lehnt regulatorische Markteingriffe wie Mietpreisbremse oder Mietendeckel kategorisch ab. Solche Maßnahmen beschleunigten vielmehr die Wohnungsnot, heißt es im Wahlprogramm. In Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt sehen die Freien Demokraten ungenutzte Potenziale vor allem in der Nutzung von Baulücken und Brachflächen, gleiches gilt für Geschoss-Aufstockungen. Die FDP will mit einem erhöhten Wohngeld auch Menschen mit geringem Einkommen den Zugang zum freien Wohnungsmarkt ermöglichen.
Linke: Die Linke will die großen Wohnungskonzerne enteignen. Im Wahlprogramm heißt es: „Großen Wohnungskonzernen wie Vonovia und Deutsche Wohnen, die systematisch Mietwucher betreiben, wollen wir das Handwerk legen." Langfristig soll der komplette Wohnungsbestand dem Markt entzogen werden und in öffentliche sowie gemeinnützige Hände übergehen. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen will die Linke weitgehend verbieten. Einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild soll es für das gesamte Bundesgebiet geben.
AfD: Die AfD setzt auf Wohneigentum: Häuslebau und Wohnungskauf sollen günstiger und einfacher werden. So will die Partei die Grunderwerbssteuer auf selbst genutzte Immobilien streichen. Wohnungsbauunternehmen in staatlicher Hand sollen ihren Mietern die Wohnung zum Kauf anbieten, der Staat fördert den soll Kauf durch die Übernahme von Bürgschaften. Die AfD meint: „Der bisherige soziale Wohnungsbau ist gescheitert.“ Vielmehr sollen einkommensschwache Mieter verstärkt mit Wohngeld unterstützt werden. Mietendeckel und Mietpreisbremse lehnt die Partei ab.
Viele weitere Infos gibt es auf unserer Themenseite zur Bundestagswahl.