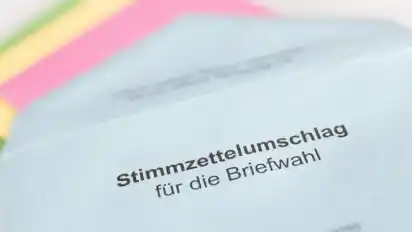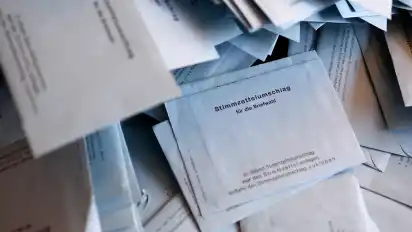- Wer soll weniger Steuern zahlen?
- Wer muss mehr Abgaben entrichten?
- Soll die Schuldenbremse eingehalten werden?
- Was ist beim finanziellen Verbraucherschutz geplant?
- Will man die Banken kontrollieren?
Am 26. September wählt Deutschland den 20. Deutschen Bundestag. Eine Wahl, die Spannung verspricht und gleichzeitig eine Zäsur ist: Kanzlerin Angela Merkel steht nicht zur Wiederwahl. Wir möchten Ihnen den Überblick zu den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien erleichtern: Dieser Teil beschäftigt sich mit Steuer- und Finanzpolitik und Fragen zu Steuererhöhungen, Abgaben, Schuldenbremse, finanzieller Verbraucherschutz und Bankenkontrolle.
Wer soll weniger Steuern zahlen?
CDU/CSU: Die Union verspricht Steuersenkungen für Privathaushalte mit kleinen, mittleren und hohen Einkommen. Der restliche Solidaritätsbeitrag für Wohlhabende würde wegfallen. Die sogenannte kalte Progression der automatischen, inflationsbedingten Steuererhöhungen soll beseitigt werden. Familien könnten unter anderem profitieren, indem der Grundfreibetrag für Kinder steigt. „Wir wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 Prozent deckeln“, heißt es im Programm. Heute sind es rund 30 Prozent.
SPD: Die Sozialdemokraten propagieren, die Steuern für Privathaushalte mit kleinen und mittleren Verdiensten zu senken. „Die extrem ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen ist nicht nur sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig.“ Man werde eine Reform der Einkommensteuer vornehmen, „die kleine und mittlere Einkommen besserstellt und die Kaufkraft stärkt“.
Grüne: Kleine und mittlere Einkommen wollen die Grünen entlasten, indem eine Regierung unter ihrer Beteiligung den Grundfreibetrag anhebt. Dadurch soll das Gefälle zur Besteuerung hoher Verdienste abgebaut werden, die heute nach Meinung der Grünen Vorteile haben.
Linke: Die Abgaben für kleine und mittlere Einkommen würden sinken, indem zum Beispiel der Grundfreibetrag auf 14.400 Euro pro Kopf wüchse. Die Steuerprogression werde verringert, um die Mittelschicht zu entlasten, schreibt die Linke. Sie nennt diese „Faustregel“: Wer als Single mit Steuerklasse I weniger als 6500 Euro im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger Steuern.
FDP: Kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet werden, indem der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro Verdienst pro Jahr greift, die Steuersätze für mittlere Einkommen sinken und automatische Steuererhöhungen infolge der Inflation unterbleiben. Dieses Modell nennt die FDP „Tarif auf Rädern“. Der bisherige Soli für hohe Gehälter fällt weg. Den Anteil der Steuern und Sozialabgaben am Verdienst wollen die Freien Demokraten unter 40 Prozent senken, während er heute über dieser Marke liegt.
AfD: „Grundsätzlich ist es das Ziel, die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland deutlich zu senken“, schreibt die Partei. Details und Zahlen nennt sie jedoch kaum. Der Staat soll sich auf Umsatz- und Einkommensteuer konzentrieren. Der Grundfreibetrag für Einkommen soll erhöht werden. Die Grund-, Gewerbe- und Energiesteuer könnte entfallen, ebenso eine „Substanzsteuer“ wie die Erbschaftssteuer. Außerdem plädiert die Partei für die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags.
Wer muss mehr Abgaben entrichten?
CDU/CSU: Die Union spricht sich grundsätzlich dagegen aus, Steuern zu erhöhen. „Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer Substanzsteuern wie der Vermögensteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer entgegen“. Laut einer Berechnung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) würden von der Finanzpolitik der Union alle Einkommensgruppen profitieren, wobei Privathaushalte mit Verdiensten ab etwa 100.000 Euro pro Jahres prozentual und absolut deutlich größere Vorteile hätten als Leute mit kleinen und mittleren Einkommen.
SPD: Die Partei will „die oberen fünf Prozent“ stärker zur Finanzierung der „wichtigen öffentlichen Aufgaben heranziehen“. Privathaushalte mit sehr hohen Verdiensten ab 250.000 Euro (Singles) und 500.000 (Verheiratete) sollen höhere Abgaben entrichten. Zusätzlich sollen die Beiträge der Wohlhabenden zur Sozialversicherung regelmäßig steigen. Außerdem fordert die SPD eine Vermögenssteuer und höhere Erbschaftssteuer auf große Betriebsvermögen. Laut ZEW würden Personen ab etwa 100.000 Euro Jahresverdienst mehr Steuern abführen.
Grüne: Leute mit höheren Verdiensten ab 100.000 Euro pro Kopf und Jahr sollen mehr Abgaben leisten. Dazu müsste der Spitzensteuersatz von heute 42 auf bis zu 48 Prozent steigen. Daneben erwägen die Grünen, eine Vermögenssteuer zu erheben, die oberhalb eines Besitzes von zwei Millionen Euro ein Prozent pro Jahr betrüge. Außerdem könnte umweltschädliches Verhalten insgesamt teurer werden. Privathaushalte mit Verdiensten ab etwa 150.000 Euro pro Jahr würden unter dem Strich draufzahlen, hat das ZEW errechnet.
Linke: Im Programm enthalten ist eine lange Liste mit Steuererhöhungen: Personen mit Gehältern ab etwa 80.000 Euro aufwärts pro Jahr müssten mehr abführen. Der Spitzensteuersatz soll auf bis zu 75 Prozent oberhalb von einer Million Euro zu versteuerndem Einkommen angehoben werden. Zugleich fordert die Linke eine Vermögenssteuer, eine zusätzliche Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Folgen, außerdem mehr Abgaben auf Erbschaften und Firmengewinne.
FDP: Von Steuererhöhungen ist im Programm keine Rede. „Wir lehnen eine einmalige Vermögensabgabe ebenso ab wie die Wiederbelebung der Vermögensteuer“, heißt es im Text. „Beides ist für unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft ein Hemmschuh bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie.“ Nach ZEW-Berechnungen profitierten alle Einkommensgruppen. Die Vorteile wüchsen mit der Höhe der Einkommen und Vermögen.
AfD: Von Steuererhöhungen ist im Programm keine Rede. Ausnahme: Die Partei will eine Digitalsteuer für Internetkonzerne. Details nennt sie nicht.
Soll die Schuldenbremse eingehalten werden?
CDU/CSU: „Wir wollen so schnell wie möglich ohne neue Schulden auskommen“, heißt es im Programm, und „bekennen uns zur grundgesetzlichen Schuldenbremse.“ Außerdem: „Grundgesetzänderungen zur Aufweichung der Schuldenbremse lehnen wir ab.“ Einschränkend ist gleichzeitig die Rede davon, dass nach der Bundestagswahl zunächst ein „Kassensturz für die öffentlichen Haushalte“ angesagt sei. CDU-Kanzleramtschef Helge Braun schrieb Anfang des Jahres, es werde eine mehrjährige Übergangszeit benötigt, um das momentane Corona-Defizit in den Haushalten zu verringern.
SPD: „Eine Politik der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg“, steht im Programm. Es soll also keine Sparpolitik stattfinden, um die Corona-Defizite auszugleichen. „Wir stehen für eine Finanz- und Haushaltspolitik, die die großen Zukunftsinvestitionen finanziert. Dazu werden wir die verfassungsrechtlich möglichen Spielräume zur Kreditaufnahme nutzen.“ Die SPD will einerseits die Schuldenbremse einhalten, nötige Ausgaben andererseits durch höhere Steuern finanzieren.
Grüne: Sie plädieren dafür, Zukunftsinvestitionen aus zusätzlichen Schulden zu finanzieren und die Schuldenbremse zu lockern. Die Partei schlägt einen kreditfinanzierten, öffentlichen Investitionsfonds außerhalb der Schuldenbremse mit jährlichen Ausgaben von etwa 50 Milliarden Euro zur Modernisierung der Energieversorgung und öffentlichen Infrastruktur vor. Wegen der gegenwärtig niedrigen Zinsen für Staatsanleihen sei die Belastung künftiger Generationen gering.
Linke: Sie bezeichnet die Schuldenbremse als „verheerend“. „Wir halten sie gemeinsam mit vielen Experten für volkswirtschaftlich schädlich und wollen sie abschaffen“, heißt es im Programm. Begründung: Die Regel im Grundgesetz verhindere zum Beispiel, dass ausreichend Geld in Schulen investiert werden könne.
FDP: Kredite, die die Schuldenbremse übersteigen, lehnt die FDP ab. „Wir stehen für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse“, sagt das Programm. „Denn jede Generation hat ihre Herausforderungen und muss über die finanzpolitischen Spielräume verfügen, um diesen gerecht werden zu können.“
AfD: Die Partei will „die Corona-bedingten Ausgabenprogramme und die dazugehörige Verschuldung auf das notwendige Maß beschränken“. Einzelheiten zur Schuldenbremse fehlen. Grundsätzlich wendet die AfD sich gegen Verschuldung auf EU-Ebene, mit der Deutschland andere Länder illegal unterstütze.
Was ist beim finanziellen Verbraucherschutz geplant?
CDU: Die Partei verspricht, dass die Steuererklärung und alles, was dafür nötig ist, künftig online abgewickelt werden kann. Privatleuten will man eher ermöglichen, Vermögen anzusammeln, indem der Sparer-Pauschbetrag und die Arbeitnehmersparzulage steigen. „Damit alle die Chancen verschiedener Anlageformen nutzen können, brauchen wir einen starken Verbraucher- und Anlegerschutz“, schreibt die Partei. Was das heißen soll, führt sie nicht näher aus.
SPD: Man will „sicherstellen, dass den Verbrauchern die Finanzierungsdienstleistungen kostengünstig angeboten werden“. Gerade für Kleinanleger sei es wichtig, „dass sie eine unabhängige und an ihren Interessen orientierte Beratung erhalten können“ – und keine, die vor allem Geldinstituten und Versicherungen diene. Die Schuldnerberatung soll gestärkt werden.
Grüne: „Wir wollen die Kompetenzen der BaFin im Verbraucherschutz stärken“, schreiben die Grünen. „Überhöhte Dispozinsen und Gebühren, insbesondere für das Basiskonto, werden wir begrenzen.“ Grundsätzlich möchte die Partei die heute übliche „Provisionsberatung“ zu einer „Honorarberatung“ umbauen. Das heißt: Beraterinnen und Berater, die Finanzprodukte verkaufen, erhalten ihre Vergütung nicht mehr von der Kapitalseite, sondern in Form von Honoraren von den Verbrauchern. Damit würden sie sich an den Kundeninteressen orientieren.
Linke: Auch hier wird angekündigt, „den provisionsbasierten Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten abzuschaffen“. Stattdessen möchte man die „Honorarberatung und unabhängige Finanzberatung durch Verbraucherzentralen stärken“. Weiterhin plädieren die Linken dafür, den Einfluss der privaten Wirtschaftsauskunftei Schufa und ähnlicher Firmen „auf den Lebensalltag der Menschen stark einzudämmen“. Außerdem will man den sogenannten grauen Kapitalmarkt „strikt regulieren“.
FDP: Die Liberalen wollen das Modell der sogenannten Easy Tax einführen: Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erhalten eine „vorausgefüllte Steuererklärung mit einem umfassenden digitalen Service“ vom Finanzamt. Die ausgefüllten Formulare soll man nur noch kontrollieren und berichtigen müssen. Ansonsten spielt das Thema Verbraucherschutz und Kundenrechte für die FDP keine wichtige Rolle.
AfD: „Bei Versicherungsverträgen, Finanzprodukten und Mobilfunkverträgen wollen wir mehr Transparenz schaffen“, heißt es hier. „Herstellerangaben und Vertragsklauseln sind in einer verständlichen Sprache zu verfassen.“ Ansonsten spielt finanzieller Verbraucherschutz keine Rolle.
Will man die Banken kontrollieren?
CDU/CSU: Konzerne soll „fair“ besteuert, beispielsweise Betrug mit der Umsatzsteuer vereitelt werden. Vor allem spricht die Union aber davon, „Bürokratie für Finanzmarktteilnehmer abzubauen, Regeln zu modernisieren und die Rahmenbedingungen für Börsengänge zu verbessern“. Von Finanzaufsicht und Kontrolle ist wenig die Rede.
SPD: „Der Finanzmarkt muss ordentlich reguliert und überwacht werden“, schreibt die Partei als Konsequenz aus dem Skandal um den zusammengebrochenen Finanzdienstleister Wirecard. Sie setzt sich beispielsweise dafür ein, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mehr Kompetenzen bei der Geldwäscheaufsicht erhält.
Grüne: Das Programm fordert eine „Finanzaufsicht mit Zähnen“. Aus der staatlichen Kontrollbehörde BaFin soll „eine Finanzpolizei mit umfassenden Prüfungsrechten“ werden. Jedes Finanzprodukt und jeder Akteur müsse reguliert sein. Um Finanzkrisen vorzubeugen, wollen die Grünen die Geldinstitute zudem zwingen, mehr Eigenkapital in Reserve zu halten. „Das riskante Investmentgeschäft muss vom Einlagen- und Kreditgeschäft getrennt werden.“ Schließlich fordert die Partei eine starke Fusionskontrolle und notfalls die Entflechtung großer Banken.
Linke: Die Partei fordert, einen „Finanz-TÜV“ einzuführen. Diese staatliche Aufsicht hätte die Aufgabe, grundsätzlich jedes neue Finanzprodukt von Banken, Versicherungen und Dienstleistern zu genehmigen. Das soll die Sicherheit der Finanzwirtschaft im Sinne der Verbraucher und Allgemeinheit erhöhen. „In Zukunft sollen nur noch solche Finanztransaktionen und -instrumente erlaubt sein, die auch einen gesamtwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nutzen stiften.“
FDP: In der Folge des Skandals um den Finanzdienstleister Wirecard will man die „BaFin zu einer besser handlungsfähigen, schlagkräftigen Finanzaufsicht weiterentwickeln und so das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland zurückgewinnen“. Die FDP „steht für eine zeitgemäße Bankenregulierung und Aufsicht, die effektiv und effizient private Gläubigerinnen und Gläubiger von Banken schützt, systemische Krisen verhindert und den Marktteilnehmern“ gleiche Bedingungen garantiert. Details fehlen.
AfD: Die Stichwörter Banken und Finanzmarkt kommen im Programm nicht vor.
Viele weitere Infos gibt es auf unserer Themenseite zur Bundestagswahl.