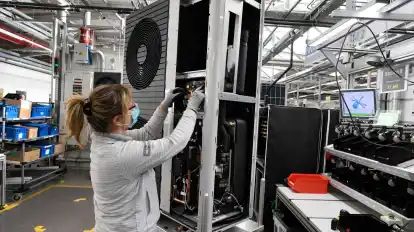An den noch zarten Weißdornstängeln bilden sich bereits die ersten weißen, stark duftenden Blüten. Hinter ihnen stehen Jungbäume in Reihen, die einmal beträchtliche Höhen erreichen sollen. Denn im Werderland soll auf einer ehemaligen Grünlandfläche ein artenreicher Mischwald entstehen – auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar hat die Hanseatische Naturentwicklung GmbH (Haneg) 11.520 Bäume gepflanzt, die von 960 Laubhölzern als Waldrand umgeben werden. Der neue Wald schließt an einen rund 30 Jahre alten größeren Baumbestand an, der den Weg zur Großen Dunge säumt.
„Da es im Frühjahr viel geregnet hat, konnten wir nicht in allen Bereichen mit Maschinen pflanzen – sie wären im nassen Boden stecken geblieben. Deshalb haben wir einige Jungbäume per Hand in den Boden setzen müssen“, sagt Hans-Ulrich Müller von der Haneg.
Bekanntlich binden Bäume mit ihrer großen Biomasse bei langer Lebens- und Wuchszeit erhebliche Mengen CO2 – neue Waldflächen sind deshalb besonders geeignet, auf den Klimawandel zu reagieren. Mehr und mehr werden deshalb in Deutschland Klimawälder gepflanzt, meist in Form robuster Mischwälder, die vorrangig der Umwelt und Natur und nicht zur Nutzung durch den Menschen dienen.
Der neue Klimawald im Werderland besteht ausschließlich aus Harthölzern wie Ahorn, Ulme und Hainbuche, den größten Anteil macht jedoch die Stieleiche aus. Um einen sanften Übergang zu den offenen Flächen des Werderlands zu schaffen, wird der neue Wald mit einem Saum aus niedrigwüchsigen Gehölzen umgeben, wie Weißdorn, Haselnuss und Schlehe.
Zu den letzten Pflanzaktionen war auch Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) angereist: „Ich habe mich vier Jahre lang für diesen ersten Klimawald in Bremen eingesetzt und freue mich, dass er nun endlich gepflanzt werden konnte“, sagt sie. Auch wenn es der erste Wald dieser Art auf Bremer Gebiet ist, soll er kein Einzelfall bleiben: „Unsere Idee ist, künftig Kompensationsmaßnahmen nach Eingriffen in die Natur nicht mehr monetär abzugelten, sondern Wald aus heimischen Gehölzarten zu pflanzen“, führt die Senatorin aus, „das Problem besonders in Bremen ist jedoch, dafür ausreichend große Flächen zur Verfügung zu haben.“ Das Umweltressort sei derzeit dabei, im Bremer Stadtgebiet geeignete Flächen zu identifizieren, die für weitere Klimawälder zur Verfügung stehen.
„Der Klimawald im Werderland wird nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern dient dem Klimaschutz und Naturschutz gleichermaßen. Und das Totholz wird selbstverständlich liegengelassen“ betont Hans-Ulrich Müller. Die bunte Mischung aus heimischen Laubhölzern soll verhindern, dass in trockenen Sommern Katastrophen wie in Fichten-Monokulturen passieren: Lang anhaltende Hitze in den vergangenen Jahren habe gezeigt, dass solche artenarmen Wälder über eine nur geringe Widerstandskraft verfügen.
Allerdings kommt der neu gepflanzte Wald im Werderland nicht ohne lenkende Pflege- und Schutzmaßnahmen aus: „Zwei Jahre lang werden wir zwischen den neu gepflanzten Bäumen eine Mulchschicht aufbringen, um das Wachstum von Pflanzen zu unterdrücken, die nicht in den Wald gehören“, sagt Müller, „und nach etwa zehn Jahren werden wir eventuell auch bestimmte Gehölze herausnehmen.“ Außerdem ist die Fläche bereits von einem hohen Wildschutzzaun umgeben, damit die jungen Bäume nicht verbissen werden – vor allem Rehwild soll aus den Flächen ferngehalten werden, das sich gern über Knospen hermacht.
Weit oberhalb der Jungbäume ragt eine Stange über den noch winzigen Wald: „Diese Jule dient als Sitzwarte für Greifvögel, wie den Mäusebussard. Diese Methode hat sich bewährt, weil damit Wühlmäuse in den Flächen klein gehalten werden“, sagt Hans-Ulrich Müller.
Da die Hauptfläche wie auch der umgebende Waldsaum ausschließlich aus heimischen Gehölzarten bestehen, wird der Klimawald zugleich zum Naturschutzprojekt: Blätter, Blüten und Holz der heimischen Gehölze werden von einer artenreichen Insektenfauna genutzt: Experten haben allein an Eiche mehr als 400 Schmetterlingsarten und mehr als 50 Bockkäferarten festgestellt. Doch bis sich diese hohe Biodiversität einstellt, müssen die Bäume beträchtlich in die Höhe gewachsen sein, und auch dann erst werden sie ihrer Rolle als Kohlendioxidspeicher gerecht: Nach Angaben der Stiftung Unternehmen Wald kann ein Baumbestand auf einer Fläche von einem Hektar pro Jahr rund sechs Tonnen CO2 festlegen.