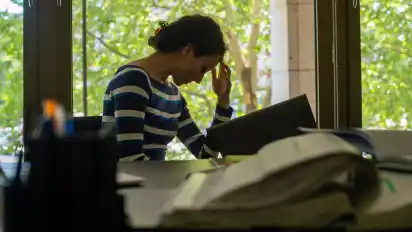Wenn es um die Erforschung von Long und Post Covid geht, spielt auch die Wissenschaft aus Bremen eine Rolle. Fachleute der Constructor University sind Teil eines Projektes, das sich ASAP nennt und vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit unter der Leitung der Dr.-Becker-Klinikgruppe gefördert wird. Ziel der Initiative ist es, Personen, die glauben, von Post oder Long Covid betroffen zu sein, dabei zu unterstützen, die notwendige medizinische und/oder therapeutische Hilfe zu erhalten. Die Auswertung des im Dezember 2021 gestarteten Projektes läuft noch bis Juni. Erste Ergebnisse verrät Studienleiterin Sonia Lippke, Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin, schon jetzt.

„Allein die Tatsache, dass wir den Betroffenen zugehört haben, hat vielen schon geholfen“, sagt Studienleiterin Sonia Lippke.
Der Online-Test
Die Forscher hatten eigens für das Projekt ein sogenanntes Online-Screening erstellt. Das war ein digitaler Fragebogen, den Betroffene, die Symptome zeigten, unkompliziert innerhalb von fünf Minuten ausfüllen konnten, um festzustellen, ob sie tatsächlich unter Post oder Long Covid leiden. Jeder Teilnehmer erhielt umgehend ein Feedback.
Von 63 Patienten, die nach dem Screening als sogenannte Interventionsgruppe an der Studie teilgenommen hatten, bestätigte sich nach eingehender Diagnostik bei 60 von ihnen der Verdacht auf Post/Long Covid. Bei dreitägigen Untersuchungen wurden unter anderem eine Lungenfunktionsmessung, ein Herzultraschall und eine Messung der Hirnaktivität (EEG) durchgeführt.
Aus einer deutschlandweiten Vergleichsgruppe, zu der auch Betroffene aus Bremen gehörten, wurde in 225 Fällen das positive Screening bestätigt, in 356 Fällen stellte sich heraus, dass die Patienten etwas anderes als Post oder Long Covid hatten, zum Beispiel Hashimoto.
Der Lotsen-Ansatz
Zwei bis drei Tage nach dem Screening wurden die Teilnehmer am Forschungsprojekt von Lotsinnen und Lotsen kontaktiert, die die Patienten fortan eng begleiteten und zum Beispiel dabei halfen, den richtigen Facharzt zu finden. Eine wichtige Erkenntnis daraus: „Allein die Tatsache, dass wir den Betroffenen zugehört haben, hat vielen schon geholfen“, sagt Lippke. „Wir waren teilweise erschrocken über das, was wir zu hören bekommen haben, wenn die Patienten von ihren Erfahrungen berichtet haben. Viele fühlten sich nicht ernst genommen oder wurden vertröstet mit dem Hinweis, geduldig zu sein oder sich bitte zusammenzureißen.“
Fazit: Da die Lotsinnen und Lotsen ihre Arbeit als sinnstiftend für sich selbst und die Betroffenen erlebten, empfehlen die Forscher, das Lotsenkonzept in die Regelversorgung zu übernehmen.
Die digitalen Hilfen
Ein weiterer Bestandteil des Projektes war die sogenannte digitale Intervention. Dabei wurden den Betroffenen aktive Übungen, zum Beispiel zur Verbesserung von Gleichgewicht und Atmung oder zur Verbesserung der Entspannungsfähigkeit, vermittelt und Therapiepläne aufgestellt. Ein Ergebnis der systematischen Überprüfung: Bei einigen Krankheitsbildern wie Depression und körperlichen Beschwerden konnten die Maßnahmen gut helfen, bei anderen Symptomen wie etwa Darmbeschwerden oder Konzentrationsschwächen war die Wirkung nur sehr begrenzt.
Eine weitere wichtige Erkenntnis: „Es gibt keine Standardbehandlung“, sagt Lippke, „wir müssen individualisierte Ansätze wählen.“ Zum Beispiel dürften Betroffene bei Reha- und Therapiemaßnahmen nicht überfordert werden. Die körperliche Belastung müsse auf die körperlichen Möglichkeiten abgestimmt sein. „Es geht nicht darum, den sogenannten inneren Schweinehund zu überwinden, sondern darum, das für jeden Richtige zu finden“, so Lippke.