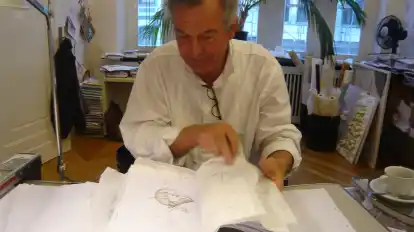Herr Platz, als ich Sie vor ein paar Tagen fragte, ob Sie mir für eine Talkshow des WESER-KURIER einen Bremer Architekten vermitteln können, der oder die auch bundesweit oder international Furore macht, mussten Sie passen. Mangelt es Bremen an wahren Baukünstlern?
Oliver Platz: Ach, Herr Hinrichs, jetzt kommen Sie mir wieder mit den Star-Architekten. Abgesehen davon, dass ich von dieser Einordnung nie viel gehalten haben – sie ist von gestern. Es gibt keinen Messias, der die eine Lösung bringt.
Wir haben in Bremen zum Beispiel einige Bauten des Schweizers Max Dudler aus Berlin, auch so ein Name. Aber okay, dann eben nicht die einzelne Person, sondern das Büro, die Mannschaft der Planer. Behagt Ihnen dieser Ansatz eher?
Klar, und das wird von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen noch viel stärker so gesehen. Gefragt ist nicht der große Auftritt, die Künstlerschaft eines Einzelnen, sondern die möglichst ganzheitliche Herangehensweise eines Teams. Und dann geht es eben nicht allein um das einzelne Gebäude, die Frage ist genauso, was es für den Ort tut, ob es das Quartier stärkt, welche Bedeutung das Haus für den Nutzer hat, ob es bezahlbar ist, wie es sich mit dem Klimaschutz verträgt. Herauskommen soll durchaus ein selbstbewusstes Stück Baukultur, aber keines mit einer arroganten Haltung. Es muss aus der Identität der Stadt heraus entwickelt werden, sonst wirkt das aufgesetzt und ist letztlich austauschbar. Nicht museal bauen, aber auch nicht zwanghaft poppig. Gerne hoch übrigens, das ist gar nicht der Punkt.
Heraus kommt in Bremen meistens Dutzendware, es wird bieder gebaut. Architektur ist Ästhetik – nicht immer, sicher, aber ein paar Hingucker sollten es schon sein. Etwas mit Strahlkraft, womit die Stadt sich schmücken kann.
Architektur ist weit mehr als Ästhetik. Architektur verbindet vieles. Was Sie meinen, sind die sogenannten Leuchttürme. Doch erstens haben wir die in Bremen, nur anders als von Ihnen gemeint. Und zweitens können Leuchttürme nur Ausnahmen sein. Wenn eine Stadt aus sich heraus, in all seiner Alltagsarchitektur, ästhetisch wertvoll ist, ist das der größtmögliche Hingucker. Ich finde ich es vermessen, Architektur, die funktioniert und eine gute gestalterische Qualität hat, herabzuwürdigen. Ist diese Art zu bauen bieder? Wahrscheinlich schon. Aber ist das schlimm? Ich finde nicht. Es ist wegen der irrsinnig hohen Baustoffpreise heute schon fast unmöglich, ein neues Haus erschwinglich zu machen. Die Kunst besteht darin, mit wenigen einfachen Mitteln und Konstruktionen ästhetisch ansprechende Häuser zu bauen, die den vielen Anforderungen gerecht werden.
Geben Sie als Architekt gerade Ihren Anspruch auf?
Nein, überhaupt nicht. Ich setze nur andere Prioritäten. Wir müssen in die Masse der Bauten mehr Qualität bringen. Beim Material, bei der Dämmung, beim Recycling. Das Ziel ist neben der Bezahlbarkeit die CO2-Neutralität. Klimaschutz! Leider wird immer noch zu wenig begriffen, wie dringlich das ist.
Vollkommen einverstanden. Aber noch einmal: Ein Haus nur noch als Zweckbau? Soll das alles sein? Schauen Sie sich in der Überseestadt zum Beispiel einen Teil der neuen Gebäude auf der ehemaligen Fläche von Schuppen 3 an. Schrecklich. Wie ein Gefängnis.
Da bin ich befangen. Mein Büro war am Architekturwettbewerb beteiligt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Es wäre unfair, etwas über den siegreichen Entwurf zu sagen, wir wären schlechte Verlierer.
Schräg gegenüber in der Überseestadt, an der Marcuskaje, ist es auch nicht viel besser: lieblos hingestellte Sozialwohnungsbauten.
Wenn die Kosten niedrig bleiben müssen, hat das Auswirkungen auf die Architektur. Dann wird es oft keine Fassade aus Ziegel, sondern eine aus Styropor mit Putz drauf. Was in der längeren Betrachtung übrigens gar nicht günstiger sein muss. Durch die Baustoffkrise hat sich diese Situation weiter verschärft. Die Industrie überzieht mit ihren Preisen, es gibt Mitnahme-Effekte mit geradezu absurden Ergebnissen. Ich kenne Projekte, die aus diesem Grund und wegen der Schwierigkeiten mit den Lieferketten kurz vor dem Kippen sind.
Nicht an den Kosten gescheitert, sondern am Anwohnerprotest, ist der ursprüngliche Entwurf für das ehemalige Bundesbankgelände in der Kohlhökerstraße. Er war von den Fachleuten hoch gelobt worden und kam auch im Senat gut an. Muss die Regierung bei solchen Projekten nicht auch mal den Rücken gerade machen und sie im gesamtstädtischen Interesse durchsetzen?
Zunächst einmal hege ich große Sympathie dafür, die Nachbarn bei solchen Plänen einzubeziehen, sie kennen sich mit der Umgebung schließlich am besten aus. In diesem Fall ging es aber vor allem darum, die Neubauten oder zumindest das Hochhaus zu verhindern. Als Ergebnis gibt es für diese wichtige Fläche am Rande der Innenstadt nun einen schalen Kompromiss: Das Hochhaus wird niedriger und breiter, die Randbebauung höher. Und ja, eindeutig, da hätte ich mir vom Senat mehr Standhaftigkeit gewünscht.
Richtig hoch, so hoch wie der Dom, sollten die Libeskind-Türme auf dem ehemaligen Sparkassengelände werden. Eine Fläche, die jetzt aus dem Gebäudebestand heraus entwickelt wird. Ihr Büro berät die Investoren, die Brüder Schapira aus Israel. Ist das in Ordnung, wenn bei einem der wichtigsten Innenstadtprojekte, zu dem die Architektenkammer eine Meinung haben sollte, deren Präsident persönlich involviert ist?
Nach dem Scheitern des Libeskind-Konzepts haben die Schapiras um Beratung gebeten, und dabei ist mein Name gefallen. Die Frage war, wie es denn jetzt weitergehen könnte. Vor der Zusage habe ich mich rückversichert, ob das einen Konflikt mit meinem Amt bedeuten könnte. So wurde das aber nicht beurteilt. Abgesehen davon, dass ich in dieser Sache mittlerweile kaum noch tätig bin, haben sich die Schapiras für die Argumente, die gegen ihr ursprüngliches Konzept sprachen, geöffnet. Sich dazu direkt austauschen zu können, den Gesprächsfaden weiterzuführen, war der Hintergrund der Beratungstätigkeit.
Die Architektenkammer wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Wo stehen wir beim Planen und Bauen? Welche Entwicklung hat es gegeben?
Wenn Sie sich erinnern, war es vor einem halben Jahrhundert, als der Bericht des Club of Rome zu den "Grenzen des Wachstums" erschien. Der unbedingte Fortschrittsglaube wich langsam einer neuen Nachdenklichkeit und dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit. Themen, die uns heute mehr denn je beschäftigen, auch und gerade uns Architekten. Es müsste wegen des rasanten Klimawandels alles sehr schnell gehen, tut es aber leider nicht; für mich fühlt sich das manchmal an, als würde ich in Watte boxen.
In die Masse der Bauten mehr Qualität bringen . . .
Richtig, so meinte ich das vorhin. Zentral ist außerdem, wie wir mit dem Bestand umgehen, und da haben Sie in Bremen endlich Ihre Leuchtturmprojekte, finde ich. Das Tabakquartier auf dem ehemaligen Brinkmann-Gelände in Woltmershausen – ein Hammer, was dort entsteht. Oder die geplanten Holzbauten auf der Überseeinsel, das werden echte Hingucker sein.