Landkreis Osterholz. Es ist ein kalendarischer Zufall und für Heike Schumacher doch auch mehr als das: Das 25-jährige Bestehen der kreiseigenen Pro-Arbeit fällt nach den Worten der Osterholzer Dezernentin zeitlich genau zusammen mit der Einführung des sogenannten Bürgergelds. Grund genug für die Vorstandschefin und den Verwaltungsratsvorsitzenden Peter Schnaars (SPD), gegenüber der Redaktion einmal öffentlich zurück und auch nach vorn zu blicken. Schnaars und die übrigen Kreistagsabgeordneten im 13-köpfigen Kontrollorgan der Pro-Arbeit tagen sonst hinter verschlossenen Türen.
Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Siegfried Ziegert hatte Anfang 1997 gerade erst seine neue Stelle als Wirtschaftsförderer beim Landkreis Osterholz angetreten, da beschloss der Kreistag im Sommer bereits die Gründung einer eigenen Beschäftigungsförderungsgesellschaft. Als Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH sollte Ziegert arbeitslosen Sozialhilfeempfängern und Jugendlichen ohne Job zu Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt verhelfen. Heike Schumacher, seinerzeit bereits Dezernatsleiterin in der Kreisverwaltung und seit 15 Jahren Pro-Arbeit-Vorstand, erinnert sich: "Wir hatten uns damals ein Modell im Kreis Herford angeschaut und waren davon sehr angetan."
Sozialstaat unter Druck
Die Ostwestfalen wollten mehr sein als eine kommunale Zahlstelle für Leistungsbezieher. Das damalige System sah aber kaum etwas anderes vor, sodass die Osterholzer Behörde mit der Pro-Arbeit einen Auftragnehmer für die ortsnahe, unabhängige Beschäftigungsförderung aufbauen musste. Der Handlungsdruck sei in jener Zeit enorm gewesen, erinnert sich der 76-jährige Schnaars, der seit elf Jahren den Verwaltungsrat der Pro-Arbeit leitet: "Es war die Zeit des zweiten Arbeitsmarktes und der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen." Wer keine Vorversicherungszeiten vorzuweisen hatte, landete rasch in der Sozialhilfe.

Kreisdezernentin Heike Schumacher fungiert seit Jahren auch als Pro-Arbeit-Vorsitzende.
Die Kreisrätin hat sich die damaligen Zahlen angesehen: Während die Zahl der Sozialhilfeempfänger in Niedersachsen von 1997 bis 2003 um 7,5 Prozent zurückging, sank ihre Zahl im Landkreis Osterholz während dieser Jahre um 31,4 Prozent: Aus 4522 Hilfeempfängern wurden 3100, die Netto-Ausgaben sanken von umgerechnet 11,5 Millionen auf 7,9 Millionen Euro. Mit der förmlichen Erweiterung des Unternehmenszwecks konnte die Pro-Arbeit Anfang 2002 ein neues Kapitel aufschlagen: Die Zusammenarbeit mit den Betrieben in der Region wurde wichtiger Daseinszweck und entsprechend enger.
Kommunale Arbeitsvermittlung
Inzwischen sind Jobvermittlung und Beschäftigungsförderung bei der Pro-Arbeit zwei Seiten einer Medaille. Kammern und Verbände, Bildungsträger, Arbeitsverwaltung und Gewerkschaften wurden zu Kooperationspartnern in zahllosen Projekten, um Beschäftigung zu sichern und anzukurbeln. Dafür konnte die Pro-Arbeit oft auch Fördermittel von Bund, Land und EU einwerben. "Ohne diese Vorerfahrung hätten wir es 2005 wohl nicht gewagt, Optionskommune zu werden", sagt Heike Schumacher heute. Seinerzeit trat Hartz IV in Kraft: Aus Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe wurde das Arbeitslosengeld II.
In Bremen, Cuxhaven und anderswo entstanden die Jobcenter als Organe der Bundesagentur für Arbeit; in Optionskommunen wie Osterholz oder auch Rotenburg und Verden schufen die Landkreise die Jobcenter. Doch statt die Aufgaben zentral im Kreishaus anzusiedeln, wählte Osterholz unter den bundesweit 104 Optionskommunen nochmal einen Sonderweg: Die Pro-Arbeit gab es ja schon, und die entsandte ihr Personal in die Rathäuser, die damit allesamt zu kleinen Ablegern des Jobcenters wurden. Die Sozialämter kümmerten sich fortan um die Grundsicherung für Arbeitssuchende in zweifacher Hinsicht: um die passiven Leistungen wie die Zahlungsabwicklung und um die aktivierenden Komponenten der Arbeitsmarkt-Integration.
Bekenntnis zum Fördern und Fordern
Landkreis und Kommunen sitzen damit in einem Boot: Förmlich ist es der Landkreis als SGB-II-Träger, der Beschäftigte unterstützt und qualifiziert. Wer aber in einer Gemeinde zum Beispiel Beratung zu einem Kita-Platz sucht, findet sein Jobcenter zwei Türen weiter. Im Bundesvergleich sei das ungewöhnlich, so Schumacher, aber: "Für unsere Verhältnisse ist es genau das Richtige." Sie glaubt, für einen arbeitssuchenden Grundsicherungsempfänger dürfte es unerheblich sein, ob er von einem Pro-Arbeit-Angestellten oder einem Gemeindebediensteten beraten wird. Entsprechend geräuschlos verlief Mitte 2005 auch die Umfirmierung der Pro-Arbeit: Aus rechtlichen Gründen wurde aus der gGmbH eine kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (kAöR) – bei praktisch unveränderter Aufgabenstellung.
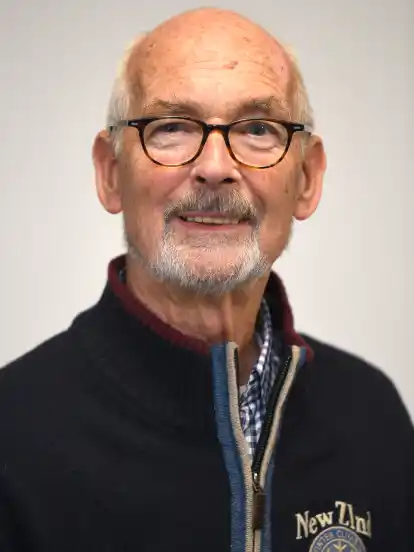
Peter Schnaars, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Pro-Arbeit.
Gefragt nach dem Grundsatz "fördern und fordern" warnt Peter Schnaars vor Verallgemeinerungen: "Es sind nicht alle Menschen arbeitsunwillig." Die Gründe, warum jemand partout ohne Job bleibe, seien extrem vielfältig. Heike Schumacher hingegen betont, es gebe für jedermann zunächst einmal die Pflicht, den Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit sicherzustellen; da gebe es kein Vertun. "Der Sozialstaat unterstützt diejenigen, die wirklich bedürftig sind." Die Mittel müssten ja auch irgendwo her kommen. 90 Prozent der knapp 50 Pro-Arbeit-Beschäftigten sind im Jobcenter tätig, dazu kommen befristete Stellen für Projekte und Maßnahmen. Mit Blick auf Hartz-IV-Statistik und Arbeitslosenquote spricht Landrat Bernd Lütjen von einer Erfolgsgeschichte: "Sämtliche Zahlen geben uns recht." Auf die Neuerungen durch das Bürgergeld sei er gespannt, aber: Beratung sei schon immer großgeschrieben worden. Und es bleibe alles in kommunaler Hand.





