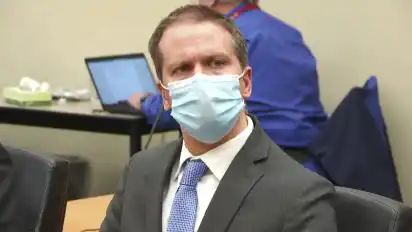Im vergangenen Sommer sind Tausende junger Menschen nicht nur in Bremen auf die Straße gegangen, um unter dem Slogan „Black Lives Matter“ gegen Rassismus zu demonstrieren. In Ihrem Buch kommt die Bewegung nicht gut weg. Was haben Sie gegen die Aktivisten?
Gar nichts. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn sich junge Menschen gegen Rassismus engagieren. Das Problem ist, dass „Black Lives Matter“ seinem Anliegen mit der Fokussierung auf Symbolpolitik keinen Gefallen tut. Der Mord an dem Schwarzen George Floyd durch einen rassistischen Cop ist etwas fundamental Anderes als wenn jemand sein Restaurant „Zum Mohrenkopf“ nennt. Und das Umstürzen von Denkmälern ändert an heutigen Unterdrückungsverhältnissen, an niedrigen Löhnen und mangelnden Aufstiegschancen nichts. Wer daran etwas ändern will, sollte das Gemeinsame in den Mittelpunkt rücken und nicht das Trennende. In den USA zum Beispiel betreffen Armut und soziale Probleme zwar in besonderem Maße Schwarze. Aber sie betreffen längst auch Millionen Menschen mit weißer Hautfarbe. Auch im deutschen Niedriglohnsektor arbeiten keineswegs nur Menschen aus Einwandererfamilien. Die sogenannte Identitätspolitik stellt in den Mittelpunkt, welche Hautfarbe, welche Abstammung oder welche sexuelle Orientierung jemand hat. Und diese Unterschiede werden zu fundamentalen Trennlinien aufgeblasen, die dann darüber entscheiden, wer über was reden darf. Dadurch werden Zusammenhalt und Solidarität zerstört.
Sie haben mit Ihrem Buch eine Debatte über Sinn oder Unsinn der Identitätspolitik entfacht. Was wollen Sie mit der Debatte erreichen?
Ich möchte, dass die linken Parteien wieder mehr Menschen erreichen. Es ist doch erschreckend: Die Union ist in einer erkennbar desolaten Verfassung. Sie hat sich über Wochen einen offenen Machtkampf geliefert, und sie hat vor allem mit ihren Ministern Jens Spahn und Peter Altmaier ein katastrophales Krisenmanagement zu verantworten. Doch obwohl die Union dadurch im öffentlichen Ansehen völlig lädiert dasteht, kommen SPD und Linke zusammen in Umfragen auf kaum noch 25 Prozent der Wählerstimmen. Da muss man sich doch fragen: Was machen wir falsch? Und ich finde, die linken Parteien machen etwas falsch. Sie orientieren sich in ihrer Ausrichtung und ihren Forderungen mehr und mehr an der Lebenswelt eines großstädtischen, relativ gutsituierten akademischen Milieus. Dadurch verlieren sie teilweise den Bezug zu denen, deren Interessenvertreter sie eigentlich sein sollten: Menschen, die um ihr bisschen Wohlstand immer mehr kämpfen müssen, Geringverdiener, Rentner mit demütigend niedrigen Renten, viele kleine Selbständige, die die Regierung in der Corona-Zeit völlig im Stich gelassen hat.
Die Kassiererin im Supermarkt erreichen die linken Parteien nicht mehr?
Zumindest erreichen wir sie immer weniger, weil Debatten über Sprachreglementierungen und Lebensstilfragen an den Problemen der Kassiererin vorbeigehen. Ihr wichtigstes Problem ist, dass sie häufig schlechte Arbeitsverträge diktiert bekommt, dass eine Tarifbindung im Einzelhandel fast gar nicht mehr existiert, dass es unendlich viele Teilzeitverträge gibt und dass am Ende des Monats ihr Einkommen einfach nicht reicht. Das sind die Kernprobleme, um die sich linke Politik kümmern muss. Und leider stellen viele Linken - und das betrifft nicht nur meine Partei - immer öfter Dinge in den Fokus, die an diesen Kernproblemen vorbeigehen.
Sie stellen in Ihrem Buch einige steile Thesen auf und neigen streckenweise auch zu einem polemischen Stil, wenn sie sich etwa über „Moralisten ohne Mitgefühl“ Gedanken machen. Leisten Sie damit nicht einen gewissen Vorschub, dass ihre eigentlichen Botschaften missverstanden werden, weil die Leute sich angegriffen fühlen?
Naja, diejenigen, die ich angreife, dürfen sich auch gerne angegriffen fühlen. Und im Gegensatz zur emotional aufgeheizten, moralisierenden Diskussionskultur finde ich mein Buch recht sachlich. Ich bekomme übrigens auch viele positive Rückmeldungen. Viele, auch viele Linke, schreiben mir, dass ihnen das Buch aus dem Herzen spricht. Den von links als „progressiv“ verklärten Lebensstil muss man sich eben leisten können. Man muss die Mieten in der Innenstadt bezahlen können, um dann mit dem Fahrrad zum Job zu fahren. Höhere Sprit- und Heizölpreise sind für einen stolzen Tesla-Fahrer, der in einer topsanierten Altbauwohnung lebt, etwas anderes als für einen Handwerker in einer Kleinstadt, der täglich seinen Diesel-Mittelklassewagen braucht. Linke dürfen diese Nöte und sozialen Probleme nie aus dem Auge verlieren.
Mit dem Beispiel der Sprit- und Heizölpreise zielen Sie vor allem auf die „Fridays for Future“-Bewegung.
Und auf die Grünen natürlich. Ja, es ist erfreulich, wenn sich junge Leute engagieren. Aber Umfragen zeigen, dass die meisten FfF-Aktivisten aus der oberen Mittelschicht kamen, also aus Familien, in denen sie soziale Probleme persönlich kaum kennengelernt haben. Niemand muss sich dafür entschuldigen, dass er aus privilegierten Verhältnissen stammt. Aber wenn Menschen, denen es noch nie an etwas gefehlt hat, dann anderen Verzicht predigen, kommt das verständlicherweise nicht gut an.
Das ist ein Problem, das gibt es in Teilen Ihrer Partei, aber auch bei den Grünen und der SPD. Sind die Bodenhaftung und der Kontakt in die Breite der Gesellschaft verloren gegangen?
Genau das ist das Problem. Nur dass die Grünen von den genannten Parteien die einzige sind, der das nicht schadet. Sie sind die Partei der urbanen, akademischen Mittelschicht par excellence, sie spiegeln deren Lebenswelt wieder und vertreten ihre Interessen. Der Fehler ist, dass SPD und Linke versuchen, mit den Grünen vor allem um diese Wähler zu konkurrieren. Damit lassen sie diejenigen im Stich, die die klassischen Wähler linker Parteien waren, also Menschen, denen Bildungs- und Aufstiegschancen vorenthalten werden, aber auch die klassische Mittelschicht, die durch Neoliberalismus, Sozialabbau und Globalisierung Wohlstand verloren hat. Wir müssen wieder die Stimme dieser Menschen sein.
Sie nennen das Buch im Untertitel ein Gegenprogramm. Ist es damit auch ein Gegenentwurf zum Programm Ihrer Partei?
Nein, es ist ein Gegenprogramm zu einem bestimmten Verständnis linker Politik. Mein Buch legt ein Programm vor, mit dem meines Erachtens soziale Politik wieder mehrheitsfähig werden könnte. Ein Programm, das sich an den Werten der großen Mehrheit ausrichtet - statt diese verächtlich zu machen. Und für viele Menschen sind stabile Gemeinschaften, Vertrautheit der Lebensumwelt und Sicherheit wichtiger als Mobilität und ein bindungsloser Selbstverwirklichungs-Individualismus, wie er in bestimmten Milieus gepflegt wird. Sie fühlen sich auch mehr als Bürger ihres Landes denn als Weltbürger. Lebensstile sind Privatsache. Aber problematisch wird es, wenn eine privilegierte Schicht ihren Lebensstil zum gesellschaftlichen Maßstab machen will. Das ist anmaßend.
Nun kommt ausgerechnet aus der Spitze Ihrer eigenen Partei lautstarke Kritik an dem Buch. Politiker wie Bernd Riexinger und Ulla Jelpke bezweifeln mittlerweile, ob Sie noch zum Programm der Linken stehen. Ist das noch Ihre Partei?
Natürlich ist es meine Partei. Ansonsten würde ich bei der Bundestagswahl nicht als Spitzenkandidatin für Nordrhein-Westfalen antreten. Es entsteht in der Öffentlichkeit schnell ein falsches Bild, wenn ein sehr lautstarker, aber deshalb nicht zwangsläufig auch sehr starker Flügel, der mich schon seit vielen Jahren bekämpft, die Medien und die sozialen Kanäle bedient.
Welche Reaktionen kommen denn von der Parteibasis?
Ich habe sehr viele persönliche Reaktionen und Mails mit sehr positiver Resonanz bekommen. Auch für meine Gedanken zur Migration und Flüchtlingspolitik. Meine zentrale These ist ja, die Förderung von Migration kann keine linke Position sein, weil sie den Herkunftsländern schadet und die Ungleichheit in unserem Land vergrößert.
Warum vergrößern Migrationsprozesse die Ungleichheit in Deutschland?
Weil gerade Zuwanderer in der Regel in sehr schlecht bezahlte Jobs gedrängt werden. Sie werden als Lohndrücker missbraucht, Zuwanderer arbeiten zum Beispiel häufig in der Leiharbeit. Auch im Dienstleistungsbereich ist nachweisbar, dass Migranten - die teilweise nicht Deutsch sprechen und deshalb besonders wehrlos sind - zu extrem schlechten Konditionen eingestellt werden. Das setzt dann die Kolleginnen und Kollegen unter Druck, die von diesen Jobs leben müssen und für die der Lebensstandard in Deutschland der Maßstab ist.
Aber für manche Ihrer Positionen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik bekommen Sie ausgerechnet Beifall von der AfD. Wie gehen Sie damit um?
Mich interessiert, ob eine Position richtig ist, nicht, wer Beifall klatscht. Man muss auch immer wieder betonen: Migration ist auch nicht im Interesse der armen Länder. Sie schädigt diese Länder, weil vor allem die besser gebildete Mittelschicht abwandert. Es wäre für die Ärmsten dieser Welt sehr viel sinnvoller, wenn Deutschland etwa seine Handelspolitik gegenüber diesen Ländern verändern würde. Wenn ihre Rohstoffe nicht mehr durch internationale Konzerne ausgeplündert würden. Wenn die Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen, das UNHCR, mehr Geld bekäme. Damit könnten wir Millionen von Menschen helfen. „Offene Grenzen für alle“ ist ein Pseudo-Humanismus, mit dem man sich selber gut und edel fühlen kann. Aber in Wirklichkeit ist das eine irreale Position, deren Realisierung in keiner Weise wünschenswert wäre.
In Ihrem Buch verwenden Sie auffallend häufig die Begriffe Heimat und Nationalstaat. Das ist für linke Politiker eher ungewöhnlich. Was ist Heimat für Sie?
Es gibt doch ein urmenschliches Bedürfnis nach Geborgenheit, nach vertrauten Umgebungen. Und deswegen haben die meisten Menschen auch einen positiven Bezug zur Heimat, also zu dem Ort, an dem sie sich wohl und zu Hause fühlen. Natürlich akzeptieren Menschen auch Wandel und sie wissen auch, dass Wandel Fortschritt sein kann. Aber in den letzten Jahrzehnten bedeutete Wandel eben oft auch Rückschritt und Verschlechterung: mehr Unsicherheit, mehr Zukunftsangst. Wenn sich Menschen dagegen wehren, haben sie recht.
Und der Nationalstaat?
Er ist ja nun mal das einzige Instrument, das wir aktuell haben, um Märkte zu bändigen, um für einen gewissen sozialen Ausgleich zu sorgen. Er ist auch in Krisen das einzig wirklich handelsfähige Instrument. Das hat sich gerade in der Corona-Krise wieder gezeigt. Ich glaube, viele Menschen würden sich wünschen, in Deutschland wäre die Impfstoffbeschaffung über den eigenen Staat abgelaufen, so wie in Großbritannien, wo mittlerweile fast die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist und die Pubs wieder öffnen. Wir hingegen bekommen gerade den nächsten Lockdown.
Das Gespräch führte Norbert Holst.
Sahra Wagenknecht ist Abgeordnete der Linksfraktion im Deutschen Bundestag und war von 2015 bis 2019 Fraktionschefin. Sie ist die Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westfalen für die kommende Bundestagswahl.
Kunstvoll verpackte Reformvorschläge
Sahra Wagenknecht hat ein Buch geschrieben, für die man kein sozial- oder geisteswissenschaftliches Studium absolviert haben muss, wie es bei Diskussionen im linken Milieu so häufig der Fall ist. "Die Selbstgerechten –
Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt" ist alles andere als theorielastig. Auf 345 Seiten schildert sie ihre Sicht der Dinge auf verschiedene Felder der Politik.
Die von der Linken-Politikerin vehement kritisierte Identitätspolitik, die das Buch in die Schlagzeilen gebracht hat, ist dabei ein wesentliches Element. Aber es geht auch vertieft um Dinge wie Finanzsystem, Umweltpolitik, Digitalisierung, natürlich auch um die soziale Frage und vieles mehr. Häufig webt die Autorin eigene Erfahrungen, wissenswerte Fakten, hochinteressante Hintergründe und erzählte Geschichte in ihr „Gegenprogramm“.
Den etwas verengten Blick der Öffentlichkeit auf ihr Buch findet Wagenknecht „ein bisschen schade“. Habe sie doch mehr vorlegen wollen als lediglich eine Polemik gegen den linksliberalen Lebensstil. Und in der Tat ist „Die Selbstgerechten“ eher ein Katalog einer Vielzahl von ausgebreiteten Reformvorschlägen – aber eben sehr kunstvoll verpackt.
Nach Angaben der Bundestagsabgeordneten ist der Erscheinungstermin eher ein Zufallsprodukt und kein gewählter Zeitpunkt mit Blick auf die Bundestagswahl. In den Jahren als Fraktionsvorsitzende, so erzählt Wagenknecht, habe sie für ein derart umfassendes Projekt schlichtweg keine Zeit gehabt.