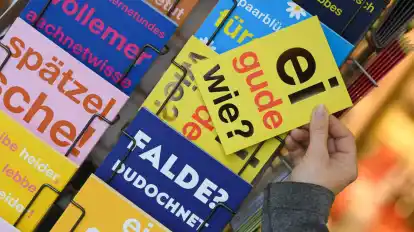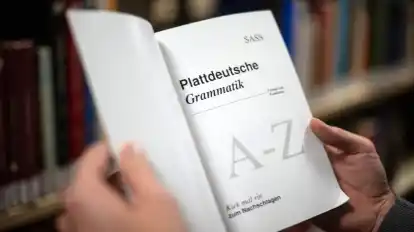In Hannover wird das beste Hochdeutsch gesprochen: Davon sind viele Menschen überzeugt, vor allem in Norddeutschland und am stärksten die Bewohner der niedersächsischen Landeshauptstadt selber. Mit der Realität hat das nicht viel zu tun – das ist ein Ergebnis des gerade beendeten Forschungsprojekts „Die Stadtsprache Hannovers“ unter der Leitung von François Conrad von der Uni Hannover.
Vier Jahre lang haben er und sein Team Menschen aus Hannover sowie aus umliegenden Städten interviewt, die dabei unter anderem Testwörter vorlesen und Gegenstände benennen sollten, die ihnen auf Bildern gezeigt wurden. „Reines Hochdeutsch wird nirgendwo in Deutschland gesprochen, auch in Hannover nicht, wie unsere Ergebnisse zeigen “, sagt Conrad und fügt im Hinblick auf den Vergleich mit anderen Städten hinzu: „In der Region Hannover-Celle-Braunschweig-Göttingen gibt es keine Unterschiede. Wobei man sagen muss: Ein besseres Deutsch als in dieser Region gibt es nicht.“
Der aus Luxemburg stammende Sprachforscher hat beobachtet, dass die Standardsprache in der jüngeren Generation in Städten in Norddeutschland sowie in Ostwestfalen-Lippe verbreiteter ist als bei älteren Menschen, die zum Beispiel häufiger „ch“ statt „g“ am Wortwende verwenden (zum Beispiel "Zuch"/Zug). Doch es gibt auch Gegenbewegungen – unter jüngeren Leuten wird zunehmend von "Füsch" statt von Fisch und von "Keese" statt von Käse gesprochen. Da stellt sich die Frage: Was ist überhaupt Hochdeutsch? Bei einer Forsa-Umfrage unter 2000 Deutschen werden vor allem kein Dialekt/kein Akzent genannt, gefolgt von einer klaren Aussprache sowie der Einhaltung grammatikalischer Regeln. Klar ist: Sprache verändert sich. Laut Conrad lassen der Duden und auch andere Wörterbücher zunehmend wie beim Beispiel "Keese"/Käse beide Aussprachen als hochdeutsche Form zu.
Bildunggrad spielt eine Rolle
Für die Studie wurden 100 Personen interviewt, die in Hannover aufgewachsen sind. Die Hälfte von ihnen hatte mindestens einen Elternteil aus Hannover, bei der anderen Hälfte stammten die Eltern nicht aus Hannover. Ergebnis: Die Herkunft der Eltern wirkte sich nicht auf die Aussprache ihrer Kinder aus. Auch das Geschlecht spielt keine Rolle, eher der Bildungsgrad (Standarddeutsch bei höherer Bildung verbreiteter) sowie das Alter. Wenn Personen einen Text lesen, benutzen sie eher die Standardform als wenn sie frei sprechen.
Studierende von Conrad haben für ihre Abschlussarbeiten in weiteren Städten das Sprachverhalten untersucht. Fiona Scherdin hat in Bremerhaven mit 32 Gewährspersonen gesprochen und ihre Ergebnisse mit einer Arbeit über Cuxhaven verglichen. Ihr Fazit: In beiden Städten wird gleich häufig vom Standarddeutsch abgewichen, wenn es um „ä“ ("Keese" statt Käse) und „g“ ("Könich" statt König) geht. In Bremerhaven wird häufiger als in Cuxhaven aus „i“ ein „ü“ (irgendwie/"ürgendwie"), in Cuxhaven dafür eher „pf“ in „f“ verwandelt (Pferd/"Ferd"). „Zwischen Cuxhaven und Bremerhaven gibt es mehr Gemeinsamkeiten als zwischen Hannover und Bremerhaven“, schreibt Scherdin. Laut Conrad sind in Regionen, in denen Plattdeutsch verbreitet ist, stärkere Abweichungen vom Standarddeutsch festzustellen als dort, wo Platt kaum noch eine Rolle spielt.
Woher kommt überhaupt die auch in Bremerhaven verbreitete Überzeugung, dass in Hannover die alleinige Hochburg des Hochdeutschen ist? Conrad hat eine Theorie: Als das Königreich Hannover 1866 nach einem verlorenen Krieg endete und von Preußen übernommen wurde, wurde die Sprache zum wichtigen Faktor für die eigene Identität. Da man über keinen eigenen Dialekt wie in den übrigen Landesteilen verfügte, wurde mangels anderer Besonderheiten die Botschaft formuliert: „Kommt nach Hannover, hier wird das beste Hochdeutsch gesprochen.“ Conrad: „Es gab und gibt eine Sehnsucht nach dem Typischen, durch das man sich von den anderen unterscheidet.“ Die Bedeutung der eigenen Sprache hat Conrad in Hannover gerade bei älteren Gesprächspartnern beobachtet, die nach dem Interview als Bestätigung für ihr vermeintlich fehlerfreies Deutsch von Conrad wissen wollten: „Wie war ich?“