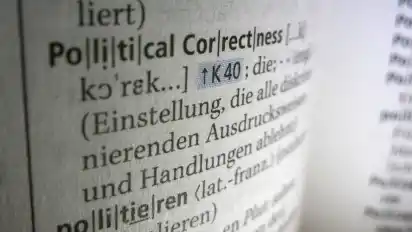Es war nach der Wahlnacht in den USA, als sich alle Welt fragte: Wie konnte das passieren? Bei der Ursachenforschung stieß man – neben vielen anderen Gründen – schnell auf einen Punkt, der hierzulande so noch gar nicht richtig wahrgenommen wurde: Die liberalen Eliten, zumal die akademischen Kreise an den Unis, hatten eine eigene Filterblase gebildet, in der die Probleme der einfachen Leute nicht mehr wahrgenommen wurden. In ihrem Bestreben, jede noch so kleine sprachliche Diskriminierung auszumerzen, hatten sie einen Kodex entwickelt, den außerhalb dieser Community kaum jemand verstand: Political Correctness.
Auch in Deutschland hat der eigentlich positive Ansatz, Diskriminierungen abzubauen, seltsame Blüten getrieben. In bestimmten Milieus streitet man sich lieber über die gendergerechte Anrede in E-Mails, als sich mit den Nöten von Niedriglöhnern zu beschäftigen. Die politische Korrektheit – inklusive der Gender Studies, die zumindest in Teilen eher Ideologie als Wissenschaft sind – hat die Sprache bürokratischer, verquaster und lebensfremder gemacht. Sie hat Fallstricke ausgelegt, in die nicht nur Rassisten tappen, sondern auch ganz normale Menschen, die sich mit den Codes der politisch Wohlmeinenden (und meist akademisch Gebildeten) nicht auskennen. Und sie engt den politischen Diskurs ein, weil sie Tabus aufbaut, kontroverse Meinungen ausschließt und viele Probleme nicht klar benennen mag.
Beispiele gibt es mehr als genug: Über die korrekte Erfassung aller Geschlechter – Binnen-I oder Gender-Gap (_) oder Gender-Star (*) oder die Endung X – sind mittlerweile ganze Abhandlungen geschrieben worden. Flüchtlinge wurden auf einmal zu Geflüchteten, weil das Wort Flüchtling männlich ist und die Endung „ling“ angeblich verniedlichend klinge (wer wirklich up to date sein will, sollte „Menschen mit Fluchterfahrung“ sagen). Und erst vor einigen Tagen entbrannte eine Debatte über ein Gedicht an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule, das die Schönheit der Frauen preist. Der Vorwurf des Asta: Sexismus.
Bremen ist wie immer Vorreiter, wenn es um eine bessere Welt geht
Solcherart Grenzüberschreitungen müssen natürlich geahndet werden: Ein älterer FDP-Herr war nach einer schmierigen Bemerkung zu einer jungen Frau an der Hotelbar politisch erledigt. Der Twitter-Hashtag „aufschrei“ wurde bundesweit berühmt. Allerdings blieben die hippen Netzfeministinnen seltsam still, als es in der Silvesternacht 2015 in Köln zu massenhaften sexuellen Übergriffen kam. Der Grund: Es waren die falschen Täter, nämlich größtenteils nordafrikanische Migranten und keine weißen Männer.
Der mit der Flüchtlingskrise in der Tat gestiegenen Fremdenfeindlichkeit wird mit einer überzogenen Rassismus-Definition begegnet, die nahezu die halbe Bevölkerung einschließt. Allein schon die Frage nach der Herkunft eines mutmaßlichen Ausländers ist verdächtig. Die Folge: Echter Fremdenhass und ein kritischer Blick auf die Zustände werden in einen Topf geworfen. Es hat zumindest den Anschein, dass das auch gewollt ist – so erspart man sich unangenehme Diskussionen. Der Bann kann selbst Politiker der Grünen wie Boris Palmer oder der FDP wie Christian Lindner treffen, die nach missliebigen Äußerungen in die rechte Ecke gestellt wurden.
Bremen ist wie immer Vorreiter, wenn es um eine bessere Welt geht. Die an Brennpunkten prekäre Sicherheitslage gerät bei Grünen und Linken schnell aus dem Blick, wenn Polizisten unter Racial-Profiling-Verdacht geraten. Der Vorwurf: Sie kontrollierten insbesondere farbige Menschen. Dass der Drogenhandel an Ecken wie der Sielwallkreuzung fest in der Hand schwarzafrikanischer Banden ist, spielt keine Rolle. Man fragt sich, ob der Rassismus-Vorwurf auch erhoben würde, wenn die Polizei bei einem Treffen eines Ku-Klux-Klan-Ablegers vor allem weiße Männer kontrollierte.
Es sind nicht nur die extremen Rechtsausleger, die sich an politisch korrekter Sprache stören. Auch ganz normale Menschen fühlen sich durch exzessive Political Correctness eingeengt – insbesondere in der Flüchtlingsdebatte. Denn es sind drängende Fragen, von denen sie oft das Gefühl haben, sie nicht stellen zu dürfen: Wie verändert sich das Land, wenn der Anteil der Einwanderer immer größer wird? Welche Rolle spielt der Islam bei der Frage, ob Integration gelingt oder nicht? Was passiert mit Brennpunktstadtteilen, wenn der Migrantenanteil weiter steigt? Es sind politisch heikle Fragen, sie können kontroverse und schmerzhafte Diskussionen auslösen. Doch wer die Debatte nicht den politischen Rändern überlassen will, muss das aushalten.