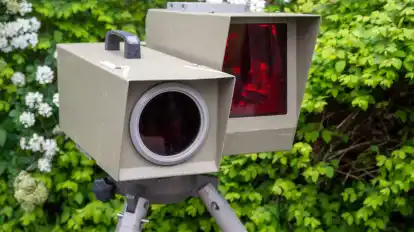Hartmut Klische erinnerte sich noch ziemlich genau an diesen Tag im Jahr 1944. Er fuhr mit seinem Fahrrad auf der Louisenstraße, als ihm das schwarze Auto entgegenkam. "Das war auffällig, weil von Zivilisten genutzte Privatwagen selten zu sehen waren", erzählte Klische, später Lehrer am Gymnasium an der Willmsstraße, am Donnerstag rund 200 Schülern der BBS I in Delmenhorst. Entweder fuhr keiner mehr, weil es kein Benzin gab. Oder die Wehrmacht hatte Wagen konfisziert. Aus dem schwarzen Wagen stiegen dann zwei Männer aus, betraten die Handelslehranstalten und kamen kurze Zeit später wieder heraus, dieses Mal mit einem Lehrer in ihrer Mitte: Otto Gratzki.
Der Tag, an den sich Hartmut Klische erinnerte, war der 21. Januar 1944, als die Geheime Staatspolizei (Gestapo) einen Lehrer festnahm, der sich dem Nazi-Regime nicht beugen mochte, der nie einen Hehl daraus machte, dass er von Adolf Hitler und dem System nichts hielt. Ein Portrait von Otto Gratzki hängt im ersten Stock der Berufsbildenden Schulen I an der Richtstraße, eben um daran zu erinnern, dass er seinen Prinzipien treu blieb und nicht einknickte. Doch das Porträt, übrigens gemalt von Josef Pollak, wirft auch von Schülergeneration zu Schülergeneration die Frage auf: Wer war dieser Gratzki eigentlich? Schüler des elften Jahrgangs des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft spürten der Frage, angestoßen von Religionslehrerin und Pastorin Anne Frerichs, seit Mai nach. In der Aula stellten sie nun ihre Ergebnisse unter dem Titel "Wiederentdeckter Widerstand" vor.
Der Pastorin war das Projekt zu dieser Zeit wichtig, weil sie über ihr Gemeindemitglied Klische auch darauf gebracht wurde, dass es jetzt noch ein paar wenige Zeitzeugen gibt, die sich an Gratzki erinnern können. Um das nötige Kleingeld einzuwerben, stellte der Förderverein der Schule einen Antrag beim Programm "Demokratie leben", der auch prompt bewilligt wurde. Und dann ging es los, fast ausschließlich in der Freizeit, weil im regulären Unterricht dann doch der Platz für so eine Arbeit fehlte. Jan Vosteen, Philipp Goetz, Mohammed Abu Dayeeh, Burak Alaca, Dennis Lukaschek und Yasemin Kacmaz spürten dem ehemaligen Lehrer nach, der nach dem Zweiten Weltkrieg kurzzeitig auch Stadtkämmerer war und schließlich für die SPD und – laut dem Stadthistoriker Paul Wilhelm Glöckner – die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) im Stadtrat saß. Einen vertiefenden Überblick über Gratzkis Lebensstationen gab der Geschichtssstudent Joscha Glanert am Donnerstag.
Glanert stützte seinen Vortrag auf der kleinen Biografie Gratzkis von Glöckner in dem Buch "Delmenhorster Lebensbilder II", herausgegeben von Werner Garbas und Frank Hethey, sowie auf eigene Archivrecherchen. Bekannt ist, dass Gratzki in ärmsten Verhältnissen in Ostpreußen aufwuchs. Ein Lehrer ermöglichte ihm die Ausbildung zum Volksschullehrer. Im Ersten Weltkrieg diente er noch als Soldat, später, in der Weimarer Republik, war er laut Glanert wohl Pazifist. 1929 schließlich kam Gratzki nach Delmenhorst als Handelsstudienrat. Schon damals war ihm die Politik der Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Unter dem Pseudonym Ernst Seelemann schrieb er das Buch "National-souveräne Volkswirtschaft: National-bedingte Waren-clearing-Weltwirtschaft", in der er darlegte, warum aus seiner Sicht die NS-Wirtschaftspolitik zum Scheitern verurteilt ist. Seine kritische Haltung zum Regime fand auch immer in seinem Unterricht Platz, was ihm einen Verweis einbrachte und das Verbot, weiter das Fach Bürgerkunde zu unterrichten.
Zum Verhängnis wurde Gratzki später ein Briefwechsel mit einem ehemaligen Schüler: Bernhard Sanders. Nachdem die Briefe entdeckt wurden, kam Gratzki bald darauf in Haft. Ein Jahr später wurde der Lehrer dann zum Tode wegen Wehrzersetzung verurteilt. Das Urteil wurde nicht mehr vollstreckt, Rote-Armee-Truppen befreiten Gratzki in Brandenburg aus dem Gefängnis. Er schlug sich danach bis Delmenhorst durch. Schon im Dezember 1945 wurde er von den Briten zum Stadtkämmerer berufen, doch 1949 schied er aus dem Dienst aus. "Daß er von 1949 bis 1952 pausieren mußte, ist auf seinen hartnäckigen Widerstand den Machthabern des Dritten Reichs gegenüber zurückzuführen. Diese Strapazen hinterließen erhebliche Spuren an dem Jubilar. Nur durch Kuren wurde er wieder fit für Schule und Politik", schrieb der DELMENHORSTER KURIER zu Gratzkis 80. Geburtstag. Von 1952 bis 1959 arbeitete er wieder als Lehrer, am 28. August 1976 verstarb Gratzki im Alter von 81 Jahren.