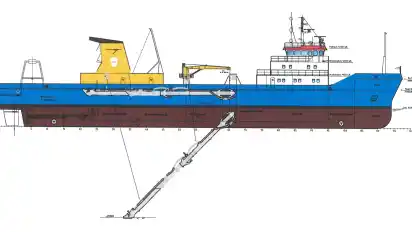Der Naturschutzbund (Nabu) hält die Elbvertiefung für gescheitert. Die Ausbaggerung des Flusses für größere Containerschiffe sei ein "überflüssiges und außerordentlich kostspieliges Abenteuer", kritisiert der Cuxhavener Nabu-Schifffahrtsexperte Klaus Schroh. Und er befürchtet, dass sich das "Desaster" bei den geplanten Vertiefungen von Weser und Ems wiederholen werde. In der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes sieht man das anders. Doch die Weservertiefung droht noch aus einem anderen Grund zum Streitfall zu werden.
Welche Tiefgänge sind auf der Elbe heute möglich?
Vor zwei Jahren hatten der Bund und die Stadt Hamburg die Elbvertiefung für erfolgreich beendet erklärt. Vom Abschluss der Arbeiten erhoffte sich der Hamburger Hafen eine Verbesserung seiner Wettbewerbsposition: Mit bis zu 13,50 Meter Tiefgang – einem Meter mehr als zuvor – sollten die Containerschiffe künftig den Hafen anlaufen oder verlassen können, unabhängig von der Tide.
Doch es kam anders: Immer wieder treiben seit der Flussvertiefung Sand und Schlick mit der Flut in die Fahrrinne und müssen erneut ausgebaggert werden. Im November vergangenen Jahres musste die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) einräumen, die neue Solltiefe der Elbe bis auf Weiteres nicht garantieren zu können – die Bagger kamen mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Stand heute können Schiffe mit 12,90 Meter Tiefgang die Elbe jederzeit passieren.
Warum halten Kritiker die Baggerarbeiten für überflüssig?
Nicht einmal die heute möglichen Tiefgänge würden von den Schiffen genutzt, rechnet Nabu-Experte Schroh vor. Der durchschnittliche Tiefgang der Containerschiffe auf der Elbe gehe sogar zurück: Im Juni lag er bei Schiffen ab einer Ladekapazität von 8000 Standardcontainern (TEU) einlaufend bei 11,75 Metern; vor einem Jahr waren es 12,59 Meter. Von den ultra-großen Containerschiffen ab 350 Metern Länge erreichten im Juni nur drei Schiffe Tiefgänge von mehr als 14,10 Metern – also die Marke, die auch vor der Elbvertiefung schon möglich war, wenn man die Flut ausnutzt. "Ernüchternd", nennt der Kapitän a. D. diese Bilanz.
Was sagen die Hafenbetreiber?
Die Hamburger Hafenwerber machen eine andere Rechnung auf: Demnach stieg die Zahl der Megamax-Containerschiffe (über 18.000 TEU) im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 234 Anläufe. Im ersten Quartal dieses Jahres beschleunigte sich der Trend noch. "Die zunehmende Zahl der Megamax-Containerschiffe zeigt eindeutig, dass die Fahrrinnenanpassung sogar mit einer vorübergehend verminderten Tiefe weiter angenommen wird", versichert Port-of-Hamburg-Sprecher Ralf Johanning. Wenn die zulässige Fahrttiefe heute nicht vollständig ausgenutzt werde, liege das zumeist an weiteren Faktoren, wie etwa schlechten Wetterbedingungen.
Wie hat sich der Containerumschlag entwickelt?
Die erhoffte Erhöhung der Umschlagleistung ist nach der Elbvertiefung ausgeblieben: 8,3 Millionen TEU gingen im vergangenen Jahr über die Kaikanten, fünf Prozent weniger als im Vorjahr und immer noch ein ganzes Stück von den fast 10 Millionen TEU entfernt, die im Rekordjahr 2007 umgeschlagen wurden. Hamburg hat über die Jahre gegenüber der Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen beständig an Umschlag verloren.
Die Elbvertiefung: Erfolg oder Misserfolg?
Angesichts dieser Bilanz verlangt Nabu-Experte Schroh eine ehrliche Kosten-Nutzen-Analyse. Die "einzig vernünftige Lehre aus dem Desaster Elbvertiefung" könne nur ein Stopp der Baggerarbeiten sein – und eine kontrollierte Rückkehr zu den Verhältnissen vor der letzten Elbvertiefung. Das sieht man in der zuständigen Bundesbehörde, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS), anders. "Auch mit den noch bestehenden Einschränkungen ergibt sich ein zusätzlicher Nutzen für die Schifffahrt gegenüber dem Zustand vor Baubeginn", versichert GDWS-Sprecherin Claudia Thoma. 20 bis 90 Zentimeter mehr Tiefgang könnten die Schiffe – je nach Größe – heute schon nutzen. "Bereits in dieser Situation ist die Fahrrinnenanpassung ein Erfolg", meint Thoma.
Wie sieht es auf der Weser aus?
Auf der Weser laufen derzeit die Untersuchungen für eine Vertiefung der Abschnitte bis Bremerhaven (Außenweser) und Brake (Unterweser). 2016 hatte das Bundesverwaltungsgericht den ersten Anlauf gestoppt; das Verfahren musste neu aufgerollt werden. Die überarbeiteten Planunterlagen für die Außenweser sollen im kommenden Jahr vollständig vorliegen, so GDWS-Sprecherin Thoma. Dann beginnt das Anhörungsverfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit.
Was unterscheidet das neu aufgerollte Weser-Verfahren von den bisherigen Planungsverfahren?
Der Bund will die Planung großer Verkehrsprojekte beschleunigen – und die Vertiefung der Außenweser könnte zur Probe aufs Exempel werden. Zum ersten Mal soll ein großes Bauvorhaben nicht auf dem bislang üblichen Verfahrensweg genehmigt werden, nämlich mit einem so genannten Planfeststellungsbeschluss. Gegen den kann vor dem Verwaltungs-, Oberverwaltungs- und am Ende vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt werden, was in der Regel Jahre dauert. Die Außenweservertiefung dagegen soll per Gesetz vom Bundestag beschlossen werden. Dagegen gibt es dann nur noch eine Klagemöglichkeit: vor dem Bundesverfassungsgericht. So sieht es ein Gesetz mit dem unhandlichen Titel Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz vor, das der Bundestag 2020 beschlossen hat.
Was hält man in Bremen von dem neuen Verfahren?
Umweltschützer laufen gegen die Kürzung ihrer Klagemöglichkeiten Sturm. In Bremen befürchtet man deshalb, dass die Außenweservertiefung zum Musterfall in diesem Grundsatzstreit wird – mit einem Verfahren bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Statt schneller ginge es also noch langsamer. Deshalb würde man in Bremen lieber einen klassischen Planfeststellungsbeschluss in die Hand bekommen. Der Bund dagegen will sein neues Gesetz endlich anwenden. Es sei jedoch nach wie vor ein Übergang auf das herkömmliche Planfeststellungsverfahren möglich, versichert GDWS-Sprecherin Thoma, da sich die Vorbereitungen für beide Verfahren nicht wesentlich unterschieden. Die Planfeststellungsbehörde werde dem Bundesverkehrsministerium nach Abschluss des Anhörungsverfahrens einen Entscheidungsvorschlag vorlegen.