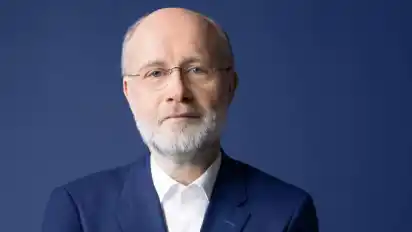Sie sind am 2. Februar in der Glocke zu Gast mit dem Merlin Ensemble Wien um Konzertmeister Martin Walch und verwenden dabei Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" für eine Klima-Erzählung. Sie grätschen also in vier Violinkonzerte mit je drei Sätzen hinein, wie muss man sich das vorzustellen?
Harald Lesch: Wir beginnen mit der Sinfonia al Santo Sepolcro, der Musik am Heiligen Grab, von Vivaldi. Das ist ein langsames Stück Musik, das zweimal wiederholt wird. Ich erzähle dazu, wie das Sonnensystem und die Erde entstanden sind. Dass es überhaupt erst zu den vier Jahreszeiten kam, weil die Erde einen Zusammenstoß hatte mit einem Einschläger so groß oder doppelt so groß wie der Mars. Dadurch hat sich die Erdachse gekippt. Am 21. März sind Tag und Nacht an allen Punkten der Welt gleich lang, dann beginnt bei uns der Frühling. Und dann beginnt auch im Konzert "Der Frühling" von Vivaldi.
Vivaldi hat jedem der zwölf Sätze Gedichte in Sonettform vorangestellt, in denen er Details der Musik erwähnt, etwa zwitschernde Vögel, Gewitterstürme, schlafende Trunkenbolde, Jäger und Eisläufer. Gehen Sie darauf ein?
Nein, ich agiere völlig frei davon. Die Musik ist dazu da, die Menschen angenehm zu unterhalten. Und ich bin dazu da, in diese Unterhaltung hinein ein paar Informationen so zu streuen, dass sie – neurologisch gut verkoppelt – ankommen. Die Mischung aus Musik, gerade aus klassischer Musik und wissenschaftlicher Information hat sich als außerordentlich tragfähig erwiesen. Unsere Gehirne lieben das eine wie das andere – und in dieser Kombination noch viel mehr. Ich spreche zwischen den Sätzen und auch in die Musik hinein. Es geht darum, welche Konsequenzen der Klimawandel für uns alle hat.
Sie kleben sich an die schöne Musik wie die Klimakleber an ein Bild im Museum?
Ich klebe an gar nichts. Aber wir benutzen Vivaldi als Vehikel. Wir erzählen zum Beispiel etwas darüber, wie alt die verwendeten Instrumente sind. Die kommen nämlich alle aus einem "Zauberwald" in Südtirol und haben diese hohe Qualität, weil das Holz eine hohe Qualität hat. Die kleine Eiszeit hat die Bäume sehr langsam wachsen lassen, diese Instrumente sind eine Art Klimaarchiv. Denn alles, was auf diesem Planeten passiert, können Sie unter dem Stichwort Klima diskutieren. Klima ist eine der Bedingungen, als Mensch auf diesem Planeten zu leben: Wenn es zu heiß ist, sterben wir. Wenn es zu kalt ist, erfrieren wir.
Sind Sie selbst musikalisch geprägt?
Ich spiele Klavier, schlecht, aber voller Leidenschaft. Gerne Filmmusik und Jazz, der Pianist Dave Bruback ist mein Hero. Und ich fühle mich in klassischer Musik sehr wohl. Oper ist nicht so mein Ding, aber Konzerte. Am wichtigsten war eine Nachbarin, die mir meine erste Schallplatte schenkte: die Brandenburgischen Konzerte von Bach, das fand ich grandios. Rock und Pop kamen erst später. Auch hatte ich einen guten Musikunterricht in der Schule.
Hat die Schule auch zu Ihrer Entscheidung beigetragen, Astrophysiker zu werden?
Ich habe an der Theo-Koch-Gesamtschule in Grünberg bei Gießen einen exzellenten naturwissenschaftlichen Unterricht genossen. Ich hatte Leistungskurs in Physik und Chemie, es gab Laborplätze, an denen wir unsere Experimente machen konnten. Auch viele Mitschüler sind beruflich in den Naturwissenschaften geblieben.
In Mathematik sollen Sie nicht so gut gewesen sein. Es gibt die Anekdote, dass Sie nach einem Sturz mit dem Fahrrad, bei dem Sie sich einen Schädelbruch zuzogen, plötzlich mathematisch hochbegabt waren. Stimmt das?
Nein. Ich bin mit dem Fahrrad gegen ein Auto gefahren und mit dem Kopf auf die Bordsteinkante geknallt. Dabei ist meine Schädeldecke gerissen. Ich war einige Wochen im Krankenhaus und durfte nur durch einen Strohhalm essen, damit sich der Kiefer nicht bewegt. Damals begann ich zu reflektieren, was ich für ein fauler Schüler gewesen bin und dass ich mich vor dem Abitur zusammenreißen sollte. Mehr steckt nicht dahinter.
Es kann ja auch nicht jeder, der mit Mathe hadert, vom Fahrrad stürzen. Wie könnte Mathematik in der Schule attraktiver werden?
Wir sollten uns fragen: Welche Art von Mathematik brauchen wir denn. Schnelles Kopfrechnen, die Grundrechenarten, Prozentrechnung, Dreisatz, einfache Geometrie und Volumenberechnung sollte jeder kennen, um sich im Leben zurechtzufinden. Alles darüber ist erst mal nicht nötig. Was oft bei einem guten Mathematikunterricht fehlt, ist die Motivation. Man muss Appetit machen. Wenn Schüler merken, für meinen Traumberuf muss ich das können, dann arbeiten sie dran. Auf meinem Schreibtisch stehen viele Lehrbücher aus der DDR, denn der Unterricht dort war viel praxisnäher als in der Bundesrepublik. Es geht zuerst darum, dass Mathematik meine Probleme löst.
Praxisnähe ist auch der Ansatz Ihrer Fernsehsendungen. Wie muss man Wissenschaft vermitteln, damit sie interessant wird? Als Abenteuer?
Die Frage ist immer: Was hat das mit mir zu tun? Ich komme als Mathematiker aus der Theorie und gehe weniger den Abenteuerweg. Ich möchte eher ganz grundlegende Dinge so elementarisieren, dass die Leute verstehen: Ah, so ist das. Man kann noch so viele Meinungen haben: Über Naturgesetze kann man sich nicht hinwegsetzen. Da ich auch Philosophie unterrichte, geht es mir auch immer darum: Wie gehen wir mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen um? Und was macht Wissenschaft mit uns? Was machen wir mit Technik, was macht die Technik mit uns?
Viele Menschen vertrauen der Wissenschaft nicht mehr. Wie gehen Sie damit um?
Es treibt mich um, zu erklären: Wie gewinnt die Wissenschaft ihre Informationen, und warum sollen wir ihr vertrauen? Beim Augenarzt legen sich die Menschen bedenkenlos unter einen Laser, der ihr Auge heilen, aber auch zerstören kann, zugleich haben sie beim Klimawandel ein fast magisches Weltbild nach dem Motto: Da kann es auch andere Erkenntnisse geben. Das Leben auf diesem Planeten funktioniert aber nicht irgendwie, da kann man nicht würfeln. Es gibt ziemlich scharfe Regeln, die dafür gesorgt haben, dass sich die ersten Lebewesen als Zellen entwickeln konnten. Heutzutage haben wir eine "Everything goes"-Diskussion, doch wir können uns nicht gegen die Naturgesetze stellen oder auf Wunderwaffen warten.
Was sagen Sie Menschen, die Sie als Öko-Spinner abtun?
In Norddeutschland haben wir jetzt eine dramatische Flut hinter uns. Die starken Niederschläge haben natürlich damit zu tun, dass die Meere so warm geworden sind. Wenn Sie mir nicht glauben, dann glauben Sie einer ökonomisch konservativen Quelle wie der Münchner Rückversicherung, die seit 40 Jahren vor den Folgen des Klimawandels warnt und aktuell eine neue Warnung herausgegeben hat – die ist sicher nicht "links-grün versifft", sondern einer der stabilsten Dividendenzahler im Deutschen Aktienindex.
Ihr Sohn ist Ingenieur für erneuerbare Technologien. Was wäre denn technisch möglich, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?
Wir müssen das, was wir können, auch machen. Jedes Dach, jeder mögliche Quadratmeter, den wir bekacheln können, sollte Photovoltaik (PV) haben, auch auf den Äckern sollten wir Agri-PV betreiben. Wir sollten Speichertechnologien entwickeln, zum Beispiel Wärmespreicherkraftwerke dorthin bauen, wo wir Kraftwerke haben. Wärmespeicherkraftwerke arbeiten mit Salzzylindern, die auf 560 Grad hochgeheizt werden. Die kann man an einen Wärmetauscher anschließen. In einem Kohlekraftwerk passiert ja nichts anderes als Kohle zu verbrennen und damit Wasser heiß zu machen. Stattdessen können Sie das Wasser auch mit 560 Grad heißem Salz erhitzen. In solchen Speichern könnte man die durch erneuerbare Technologien gewonnenen, nicht verbrauchten Energien einlagern und dann die vorhandene Infrastruktur nutzen. Und wir sollten Windräder bauen. Diese Technologien sind schon alle da und können eingesetzt werden. Wir müssen nicht auf Start-ups oder Raketenphysik warten.
Sind wir noch zu retten? Wie optimistisch sind Sie?
Zum Weltuntergang wird es wohl nicht kommen. Aber es wird schwerer, die fetten Jahre sind vorbei. Die Welt muss sich zusammentun, um die Natur, die Wälder, das Trinkwasser zu schützen. In Deutschland sollten wieder alle Menschen miteinander sprechen, ohne sich anzubellen. Nur gemeinsam kann man die Herausforderungen einer solchen Transformation schaffen. Da gibt es kein Patentrezept. Aber wir haben in Deutschland einige Gemeinden, die sind ziemlich weit. Wir könnten Vorbilder verwenden wie Wildpoldsried im Allgäu, das siebenmal mehr Storm produziert als es verbraucht. Stärken stärken und diese Diskussionen aus dem politischen Klein-Klein heraushalten.
Was kritisieren Sie an der politischen Debatte?
Ich höre zu viele radikale Stimmen, die dazu noch von großer technischer Ahnungslosigkeit geprägt sind. Wenn zum Beispiel der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erzählt, dass 25 Quadratkilometer Aufforstung ausreichen, um die CO2-Emissionen der Deutschen zu kompensieren, dann ist das Unsinn. Klimawandel und Energiewende sind keine ideologischen Fragen, sondern Sachfragen. Wir können uns nicht darüber streiten, dass die Sonne im Osten aufgeht.
Was erwarten Sie von den Politikern?
Jeder Hausbesitzer, der vernünftig ist, setzt sich Solarzellen aufs Dach und schafft sich eine Wärmepumpe an. Die Politik sollte dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Bei der Mobilität könnte sie etwa die Anschaffung eines großen Verbrenners wie in Frankreich mit einer Strafsteuer belegen. Das wäre im Land der SUVs ein Zeichen. Das Gute fördern, darauf kommt es an. Und miteinander reden: Langfristig kann es keine Lösung sein, den Agrardiesel zu fördern, aber eine Subvention im Handstreich abzuschaffen, ist ein riesengroßer Fehler. Man könnte sich mit den Bauern zusammensetzen und fragen, wie geht es vor Ort. Da ist viel Kommunikation notwendig. Der Staat sollte gucken, wie man deeskalieren kann.
Was tun Sie selbst zur CO2-Reduzierung?
Ich fahre zwar noch einen kleinen Verbrenner, versuche aber möglichst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Auch bei der Ernährung orientiere ich mich um – trotz der Probleme mit meinem Erbgut: Ich bin ich in einer Gastwirtschaft mit Metzgerei großgeworden. Aber der ganz große Hebel, an dem eine Gesellschaft drehen kann, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, das sind die erneuerbaren Energien und die Mobilität. Eine Schule in Bayern hat ausgerechnet, dass sie ihren CO2-Ausstoß um 70 Prozent senken könnte, wenn kein Schüler mehr mit dem "Elterntaxi" fahren würde.
Fahren Sie denn noch Fahrrad?
Ja, ein altes Hollandrad. Und um wieder zur Musik zu kommen: "Fahrrad fahr'n" von Max Raabe gehört zu meinen Lieblingssongs.