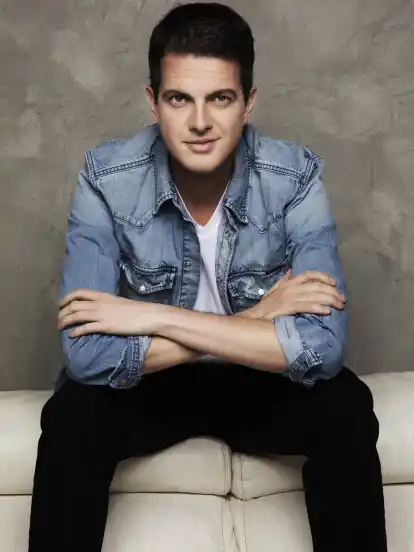Herr Jaroussky, Glückwunsch, Sie erhalten den Bremer Musikfest-Preis. Zu einem Zeitpunkt Ihrer Karriere, an dem Sie Ihre Gesangsaktivitäten stark zurückfahren. Zur rechten Zeit?
Philippe Jaroussky: Ja, zur rechten Zeit. Ich bin oft in Bremen gewesen. Dass ich in diesem Jahr ein Programm präsentieren kann, in dem ich sogar Mozart und Schubert auf Deutsch singe, macht mir große Freude. Ich höre auch noch nicht auf, nicht mal als Sänger. Ich habe immer noch Träume. Dafür, denke ich, ist dieser Preis. Und dafür ich bin höchst dankbar und fühle mich geehrt.
Was für Träume?
Zu dirigieren. Und live anders zu singen als man dies im Studio tut. Ich träume davon, dass man Countertenöre nicht mehr immer nur mit Kastraten-Arien identifiziert. Also: nicht immer nur italienische Barock-Oper. Letzteres war eines von zwei großen Zielen, die ich mir vorgenommen hatte. Übrigens glaube ich nicht, dass ich auch heute noch, wenn ich anfinge, so leicht Karriere machen könnte wie damals. Wir Countertenöre sind viel mehr geworden. Woran ich selber übrigens nicht unschuldig bin. Wenn ich heute anfinge, müsste ich mich vor Kerlen wie mir in Acht nehmen.
Worin bestand Ihr zweites Ziel?
Zu zeigen, dass wir keine Freaks sind. Keine Monster. Die Barockmusik, als ich anfing, war sehr stark auf Virtuosität ausgerichtet, und die Countertenöre auch. Man unterstellte uns ein Übermaß an Flamboyance, Exotik und auch eine irgendwie besondere, seltsame Gesangstechnik. Wir galten als Paradiesvögel. Heute nicht mehr. Wenn ich mit Liedern auftrete, erscheine ich, trotz der hohen Töne, als ein ganz normaler Sänger, glaube ich. Übrigens besonders in Deutschland. “Opium” ist mein in Deutschland am Besten verkauftes Album. In Frankreich nicht.
Sind Countertenöre heute keine Außenseiter mehr?
Gewiss sind sie es. Countertenöre werden kaum je für Galas oder große Eröffnungen eingeladen. Die Elbphilharmonie, bei deren Einweihung ich ja singen durfte, war eine Ausnahme. Einige von uns Sängern sind zwar bekannt. Dass unser Repertoire etwas wert ist, das müssen wir immer noch beweisen.
Erleben Sie heute noch ein Raunen im Saal, wenn Sie den ersten Ton gesungen haben?
Das kennt bis heute noch fast jeder meiner Kollegen. Allerdings ist es kein Schock-Erlebnis mehr. Was ich stattdessen erfahre, ist eher ein Sympathiebonus, ein Entgegenkommen des Publikums. Wenn ich ganz ehrlich sein soll: Wir Countertenöre kriegen auch an schwachen Tagen die volle Liebesration.
Was daran liegen dürfte, dass man Sie nicht nur als Sänger wahrnimmt?
Genau. Männer, die so hoch singen wie eine Frau, erwecken den Eindruck von Mut und Verletzlichkeit zugleich. Das rührt. Ich merke nach Vorstellungen immer wieder: Das Publikum will mich beschützen. Es kommen Menschen zu mir, die ich ja gar nicht kenne, und sagen mir in warmherzigstem Ton: “Pass auf dich auf.”
Wie lange, glauben Sie, kann Ihre Gesangskarriere noch andauern?
Wenn alles gut, würde ich sagen: zehn Jahre. Allerdings werde ich in dieser Zeit viel weniger als Sänger auftreten als heute. Ich will das hysterische Repertoire, also die virtuosen italienischen Opern-Partien, kaum noch singen. Andererseits möchte ich nicht abtreten, ohne in den Passionen von Bach aufgetreten zu sein. Ich werde mir dafür mindestens je ein Jahr Vorbereitungszeit gönnen. Es ist mir sehr wichtig.
Viele Countertenor-Karrieren, aber nicht alle, neigten sich frühzeitig dem Ende zu. Ist der Countertenor fragiler, empfindlicher, anfälliger als andere Sänger?
Ich glaube das nicht. Auf Tenöre trifft es genauso zu, auf viele Soprane auch. Es liegt an den hohen Noten, ist eine Frage der Natur und natürlich auch der Gesangstechnik. Wer lange singen will, muss seinen Lehrer behalten. Auch dann noch, wenn man längst von einem Engagement zum nächsten eilt. So habe ich es gemacht.
Neben Schubert und Mozart singen Sie in Bremen auch Komponisten wie Rossini und Britten, die für Sie eher Neuland sind. Was davon ist am schwersten?
Schubert, ganz klar. Ich habe unlängst ein ganzes Album mit Schubert-Liedern aufgenommen und war nachträglich so unzufrieden, dass wir alles noch einmal von vorn gemacht haben. Wann es veröffentlicht werden kann, weiß ich bis heute nicht. Mit ganzen Lieder-Zyklen wäre es möglicherweise noch schwieriger. Ich möchte zwar gern Schumanns “Dichterliebe” singen. Aber: “Ich grolle nicht”, das ist nichts für mich.
Mit Thibaut Garcia steht Ihnen diesmal ein Gitarrist zur Seite. Sie können so leise singen wie sonst nie?
Ganz genau, das geht nur mit Thibaut. Und ist ja auch der Witz der Sache. Für ihn bedeutet es übrigens eine größere Herausforderung als für mich, denn für die allermeisten Lieder mussten wir die Transkriptionen erst anfertigen. Wir neigen in der Oper gern dazu, überzuinterpretieren. Das geht hier nicht. Das Format ist das persönlichste, intimste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Es gab sogar Lieder in der ursprünglichen Auswahl, die so privat waren, dass ich sie nicht hinbekam. Zum Beispiel “La solitude” der französischen Chanson-Sängerin Barbara. Es geht mir zu nahe. Es gehört ihr. Stattdessen haben wir ihr Chanson “Septembre” dabei. Und einen Bossa nova von Luiz Bonfa.
Angenommen, Sie könnten selber jemandem den Bremer Musikfest-Preis übergeben, wer wäre es?
Mal überlegen … gern einem deutschen Künstler. Also: Andreas Scholl. Er ist mein absoluter Favorit, ich habe ihn viele Jahre bewundert wie kaum einen zweiten. In der Oper war auch der amerikanische Countenor David Daniels wichtig für mich. Und in Frankreich Gérard Lesne und Henri Ledroit. Der größte Countertenor für mich aber ist ohne Frage Andreas Scholl.
Das Gespräch führt Kai Luehrs-Kaiser.