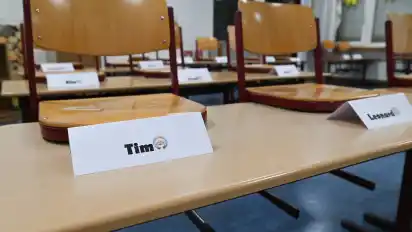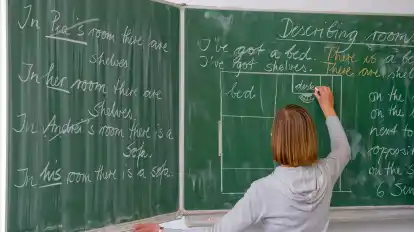Kaum hat die Schule angefangen, geht es wieder los: Mal fallen die ersten beiden Stunden aus, dann die letzte oder andersherum. Mit banger Erwartung öffnen die Eltern den digitalen Stundenplan ihrer Kinder, jeden Abend und Morgen das gleiche Spiel. Und dann ist er auch schon wieder da: der durchkreuzte Stundenblock. Es vergeht keine Woche ohne Stundenausfälle, die Ausnahme ist zur Regel geworden.
Vor allem berufstätige Eltern sind immer wieder als Zeitmanager gefragt. Besonders bei kleineren Kindern, die nicht ohne Weiteres ohne Betreuung bleiben können. Doch darum geht es gar nicht in erster Linie. Man fragt sich: Funktioniert das System Schule eigentlich noch? Oder kann Schule nicht mehr einlösen, was doch der Auftrag des Staates ist? Nämlich die Kinder umfassend zu bilden, ihnen Allgemeinwissen zu vermitteln?
Schulpflicht ist keine Einbahnstraße. Nicht nur der Nachwuchs hat die Pflicht, Unterricht zu besuchen. Auch der Staat als Schulträger steht in der Pflicht, für eine angemessene Schulbildung zu sorgen. Für eine Schulbildung, die kontinuierlich verläuft. Die nicht nur darin besteht, wieder und wieder Löcher zu stopfen oder es gleich bleiben zu lassen. An einem durchgehenden Unterrichtsangebot hapert es ganz offenbar. Und zwar nicht erst seit gestern.
Man kann der Bildungsbehörde nicht vorwerfen, sie würde dem Drama tatenlos zusehen. Mit Seiten- und Quereinsteigerprogrammen, mit der Einstellung ausländischer Lehrkräfte versucht sie, Personalreserven auszuschöpfen. Im föderalen Bildungssystem jagen sich die Länder verstärkt untereinander die Lehrkräfte ab – jedes Land ist sich selbst das nächste.
Sogar Bremen und Bremerhaven konkurrieren untereinander um den Lehrernachwuchs. Bildungssenatorin Sascha Aulepp (SPD) kann darauf drängen, dass die Länder ihre Bemühungen koordinieren. Aber sie weiß: Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Im Wettbewerb um gerade ausgebildete Lehrkräfte regiert der Ellenbogen. Am Ende steht das Eingeständnis: Der Markt ist leer gefegt, wir bekommen nicht genügend Lehrer.
Offiziell sind in der Stadt Bremen knapp 100 Lehrerstellen nicht besetzt. Das ist dramatisch, wenn man sich die dünne Personaldecke an den Schulen vor Augen hält. Dass eine Versorgung von 100 Prozent nicht ausreicht, liegt auf der Hand. Es gibt immer Krankheitsfälle. 105 Prozent sind nach Ansicht von Achim Kaschub, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung Bremen, das Mindeste.
Doch selbst dieses Mindestmaß wird an zahlreichen Schulen nicht erreicht. Für Schlagzeilen sorgte unlängst die Grundschule Am Wasser in Bremen-Nord mit einer katastrophalen Unterversorgung von 77 Prozent. Die logische Folge: haufenweise Unterrichtsausfälle, verzweifelte Eltern, frustrierte Lehrkräfte. Senatorin Sascha Aulepp höchstpersönlich stattete der Schule einen Besuch ab und versprach Besserung.
Doch was kann Aulepp tun, wenn neue Lehrkräfte nicht zu bekommen sind? Sie kann das gefürchtete Instrument der Abordnungen anwenden. Das macht sie jetzt – zaghaft, aber immerhin. Sie kann den Schulen das Stellenmanagement entreißen, es zentralisieren, um der Schieflage bei der Lehrerversorgung Paroli zu bieten. Auch das ist geschehen.
Was bleibt, um den Mangel zu verwalten? Sicherlich könnte man auch noch die letzten heiligen Kühe schlachten. Schon wird die Forderung laut: Weg mit den vielen Teilzeitregeln! Doch es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeit, wenn es um die Pflege von Angehörigen oder die Kinderbetreuung geht. Und oft genug ist zu hören: Lehrer reduzieren, arbeiten aber trotzdem am Anschlag.
Gleichwohl dürfen fehlende Personalressourcen keine Ausrede für ein löchriges Unterrichtsangebot sein. Lehrerinnen und Lehrer nehmen zahlreiche Aufgaben wahr, die auch nicht-pädagogisches Personal übernehmen könnte. Auf diesem Feld ist die Verwaltung handlungsfähig. Oder jedenfalls handlungsfähiger als auf dem Kampfplatz der Lehrergewinnung. Sie muss es nur noch unter Beweis stellen.