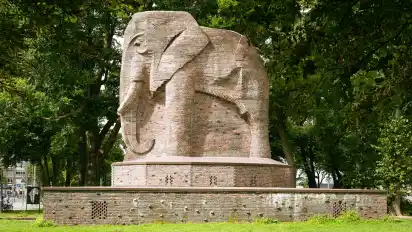Wer sich auch nur am Rande mit der Geschichte des Kolonialismus befasst, wird ihn auf alten Fotos und Bildern immer wieder entdecken: den Tropenhelm. Wie kein anderes Kleidungsstück seien diese leichten Kopfbedeckungen zum Symbol europäischer Kolonialherrschaft geworden, so Historikerin Laura Haendel. Denn: "Nicht nur Soldaten, auch Kolonialbeamte, Missionare und Touristen trugen sie." Hergestellt wurden die deutschen Modelle in Bremen, in der laut Eigenwerbung "ersten deutschen Tropenhelmfabrik" an der Riensberger Straße. Im Sommer 1900 lieferte die Firma von Ludwig Bortfeldt 28.000 Helme "für die ostasiatische Expedition" aus – gemeint war die multinationale Interventionstruppe zur Niederschlagung des chinesischen "Boxeraufstands".
Der Haendel-Beitrag befasst sich mit einem weithin vergessenen Kapitel der kolonialen Geschichte Bremens. Zu finden ist der Kurzaufsatz in einem neuen Buch, das die beiden Herausgeber Norman Aselmeyer und Virginie Kamche an diesem Donnerstag um 18 Uhr im Haus der Wissenschaft offiziell vorstellen wollen. Genau 50 Beiträge beleuchten, wie Bremen laut Untertitel "den deutschen Kolonialismus prägte". Der Titel "Stadt der Kolonien" ist ein Bremer Werbeslogan aus der NS-Zeit und dürfte manch einem bekannt vorkommen. So hieß schon einmal ein Buch, das 2016 als Begleitband zur Reihe "Aus den Akten auf die Bühne" herauskam. Damals war der Titel allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen.
Mit ihrem Buchprojekt betreten Aselmeyer und Kamche Neuland. "Bisher gibt es kein Überblickswerk zur kolonialen und postkolonialen Geschichte Bremens", sagt Aselmeyer, wissenschaflicher Mitarbeiter an der Uni Bremen mit dem Schwerpunkt Kolonialgeschichte und Geschichte Afrikas. Ausdrücklich wendet sich das 288-Seiten-Buch nicht nur an gelehrte Geister. "Mit kurzen, prägnanten Beiträgen wollen wir ein breites Publikum erreichen", betont der 40-Jährige. "Es soll keine Hürde sein, in diesem Buch zu lesen." Deshalb sind die einzelnen Beiträge meist auch nur fünf Seiten lang und bemühen sich um allgemeinverständliche Sprache. Das erklärte Ziel: einen ansprechenden Mix der wichtigsten Fakten zu liefern. Dabei kommt mancherlei Neues zum Vorschein: ob es nun um Bremen als Hochburg der Tropenhelm-Produktion geht oder die Geschichte der Deutschen Südsee-Phosphat AG aus der Feder der Bremer Geschichtsstudentin Lea Wesemann.
Die Themen sind weit gestreut. Neben dem wissenschaftlichen Nachwuchs beackern ausgewiesene Experten aus dem In- und Ausland verschiedenste Gebiete von kolonialer Baumwolle bis hin zu prominenten Akteuren wie dem "Kolonialpionier" Adolf Lüderitz. Doch es wird nicht nur die Täterseite in Augenschein genommen. Im Abschnitt Personen taucht auch der Togolese Johannes Kohl auf, der 1927 einen Antrag auf Einbürgerung stellte und damit scheiterte, interessanterweise aber nicht am Widerstand der Bremer Behörden.
Der Blick reicht bis in die Gegenwart. Unter dem Titel "Gier, Genozid und grüner Wasserstoff" setzt sich der deutsch-namibische Politologe Henning Melber kritisch mit der wirtschaftlichen Ausbeutung Namibias auseinander, der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Aktuelle Aspekte wie etwa Rassismus und Kolonialismus in Bremer Schulbüchern lagen vor allem Virginie Kamche am Herzen. Die Mitbegründerin des Afrika-Netzwerks Bremen und Bremer Frau des Jahres 2023 beklagt anhaltende Vorbehalte gegen schwarze Menschen. "Wir leiden darunter", sagt die 59-Jährige.
Das Buchprojekt hatte eine kurze Vorlaufzeit, erst im vergangenen Jahr wurde die Idee geboren. Und zwar aus dem Wunsch heraus, kolonialpolitische Diskurse mit leicht zugänglichem Wissen zu unterfüttern. "Es ist auch mal gut, Fakten zu haben", sagt Kamche. Allerdings hat sich bei beiden Herausgebern ein Gefühl der Frustration eingestellt. Aselmeyer und Kamche erinnern an das "Bremer Erinnerungskonzept Kolonialismus", das 2016 mit viel Ehrgeiz gestartet wurde. Doch die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Bremens und seiner Folgen bis in die Gegenwart ist über zaghafte Ansätze kaum hinausgekommen. "Ich habe den Eindruck, Bremen will das nicht", sagt Kamche. Es werde mehr geredet als getan. Zwar sind Mittel der Wissenschaftsbehörde in das Buchprojekt geflossen. Dennoch scheiterte der Versuch, den Sammelband in der Bürgerschaft oder im Rathaus zu präsentieren. "Es ist eben alles nur Symbolpolitik", sagt Aselmeyer.
Dass das Bremer Afrika Archiv noch immer keine neue Bleibe gefunden hat, sieht der Historiker als symptomatisch an. Den Unterlagen droht in Kürze der Altpapiercontainer. Bislang werden sie an der Uni verwahrt, mit dem Umzug der Juristen im September muss aber auch das Afrika Archiv weichen. Als letzte Option hat Aselmeyer jetzt Altbürgermeister Carsten Sieling (SPD) gebeten, seinen Einfluss geltend zu machen. "Dabei geht es hier einfach nur um einen Raum. Nur darum, das Material zu sichern."
Aselmeyer selbst wird sich um die Belange der kolonialen Aufarbeitung schon bald nicht mehr kümmern können – sein Vertrag an der Uni läuft aus, der 40-Jährige wechselt nach Oxford. Das neue Buch ist so etwas wie sein Vermächtnis.