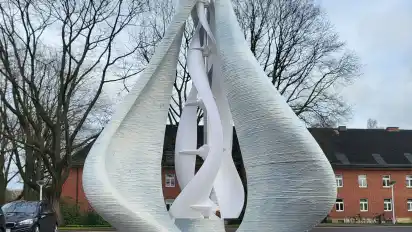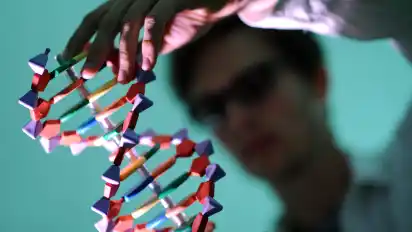Zwei Jahre in Folge hat der Verkehrssektor in Deutschland seine Klimaschutzziele verfehlt. 2022 entfielen auf den Verkehr 148 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent anstelle der erlaubten 139 Millionen Tonnen. Dabei leiten sich die Ziele aus dem deutschen Klimaschutzgesetz ab. Auf Druck der FDP hat die Bundesregierung reagiert – und die Sektorziele abgeschafft. Nun müssen andere Sektoren das Defizit des Verkehrssektors kompensieren. Ökonomen wie Klimafachleute halten das für fatal. Kann Deutschland so noch seine Klimaschutzziele erreichen? Was wäre nötig, damit der Verkehrssektor seinen Beitrag leistet?
„Der Verkehrssektor ist alles andere als auf Kurs“, bestätigt Beate Zimpelmann, Professorin für Politikmanagement an der Hochschule Bremen. „Wir bräuchten jährlich eine Verringerung um sieben Millionen Tonnen CO2, haben aber eine Verringerung um 0,5 Millionen Tonnen“, kritisiert die Nachhaltigkeitsforscherin. „Wir müssten das Tempo vervierzehnfachen.“
Überraschend wirkungsvoll: das Tempolimit
Möglich wäre das: „Eine zentrale Maßnahme wäre ein Tempolimit, da lassen sich die Grünen von der FDP über den Tisch ziehen“, findet Zimpelmann. Denn es geht keineswegs nur um den direkten Effekt der CO2-Reduzierung um drei Prozent: „Ein Tempolimit hat Auswirkungen auf Größe und Design der Autos und den Verkehrsfluss als solchen“, betont die Expertin. Dieser indirekte Effekt wäre weit größer als der direkte. Die Deutsche Umwelthilfe geht davon aus, dass ein kostengünstig und schnell umzusetzendes Tempolimit jährlich elf Millionen Tonnen CO2 vermeiden würde. Außerdem verringert es Staus und erhöht die Sicherheit.
Die Neuzulassungen belegen die Fehlentwicklung: 2022 stießen neu zugelassene Pkw laut Kraftfahrzeugbundesamt im Mittel 120 Gramm CO2 pro Kilometer aus, 11 Gramm mehr als 2021. Lässt man Elektroautos und Hybride außen vor, erzeugen neue Benziner 150,5 Gramm CO2 pro Kilometer, Diesel-Neuwagen sogar 168 Gramm. Auch deshalb wäre ein Tempolimit wichtig, wie Meike Jipp, Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung am DLR erläutert: „Gemessen am Fahrzeugbestand werden jährlich nur wenige neue Fahrzeuge neu zugelassen. Deshalb werden wir über Jahre hinweg hauptsächlich Verbrenner-Pkw und -Lkw auf den Straßen sehen. Einen großen Hebel haben somit Maßnahmen, die auf einen effizienteren Betrieb dieser Verbrenner abzielen.“
Nicht zuletzt sollten die europäischen Flottengrenzwerte Elektroautos anders betrachten: „Bei E-Fahrzeugen fehlt bislang ein Anreiz für besonders effiziente, also kleine und leichte Fahrzeuge, da diese derzeit unabhängig von ihrem Energieverbrauch als Nullemissionsfahrzeuge angerechnet werden“, kritisiert Thorsten Koska, Experte für Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Wasserstoff und Synfuels keine Alternative zu Elektro
Um den Anteil der Elektroautos schneller zu steigern, wären weiterhin staatliche Förderungen beim Kauf hilfreich, und die Ladeinfrastruktur müsste schneller ausgebaut werden. „Da mache ich mir aber keine Sorgen“, sagt Zimpelmann, „die E-Mobilität wird staatlich vorangetrieben, es gibt eine Lobby und die Autoindustrie hat sich darauf eingestellt.“ Damit E-Autos ihre Stärke voll ausspielen können, müssen sie jedoch Ökostrom tanken können. Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien ist deshalb auch für Verkehrssektor wesentlich.
Von Wasserstoff als Kraftstoff für Pkw hält Zimpelmann ebenso wenig wie andere Fachleute. Auf absehbare Zeit wird mit erneuerbaren Energien erzeugter Wasserstoff nur begrenzt verfügbar sein und sollte daher dort eingesetzt werden, wo er unbedingt benötigt wird, etwa in der Stahlindustrie. Abgesehen davon benötigt ein Wasserstoffauto für einen Kilometer Fahrt aufgrund der geringeren Effizienz doppelt so viel Ökostrom wie ein Elektroauto. Ein Auto mit synthetischem Kraftstoff würde sogar das Sechsfache benötigen.
Wichtig sei daher, den Fahrzeugbestand insgesamt zu verkleinern. In Bremen hat die Enquetekommission zur Klimaschutzstrategie das Ziel gesetzt, dass es bis 2038 zwei Drittel weniger Autos geben soll. „Was der Bundesverkehrsminister macht – der Ausbau der Straßeninfrastruktur –, ist der falsche Weg“, kritisiert die Forscherin. Sinnvoller sei es, über Steuern Autos und deren Nutzung zu verteuern. Andere Länder erheben beispielsweise eine hohe Neuzulassungssteuer, die eine weit stärkere Lenkungswirkung entfaltet als die eher geringe jährliche Kfz-Steuer in Deutschland. Weiterer Hebel: Weil Dienstwagen einen Großteil der Neuwagen ausmachen, entscheiden sie mit darüber, wie sich der deutsche Fuhrpark zusammensetzt. Wären nur Dienstwagen mit niedrigem CO2-Ausstoß steuerlich absetzbar, würde das die Emissionen im Verkehrssektor spürbar senken.
Weniger Autobahnen, mehr Radwege
„Wir brauchen eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene, von der Straße auf Öffentliche Verkehrsmittel, Rad- und Fußgängerverkehr“, sagt Zimpelmann. Nötig sei der Ausbau der Bahn, keinesfalls ein Ausbau der Autobahnen. Studien haben immer wieder belegt, dass mehr Straßen mehr Verkehr erzeugen. So, wie mehr sichere Radwege mehr Radverkehr hervorbringen; Paris ist das eindrucksvollste Beispiel dafür. Für Bremen könnte das bedeuten, zunächst marode Fahrradwege zu reparieren sowie Fahrradstraßen und Tempo-30-Zonen auszubauen. „Damit könnte man schon viel erreichen, ohne ganz viel zu investieren“, urteilt Zimpelmann. Außerdem müssten die lange diskutierten Radbrücken über die Weser endlich kommen.
Bundesweit sieht die Forscherin im 49-Euro-Ticket bislang die einzige Maßnahme, nennenswert die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Gut sei, dass manche Kommunen das Ticket ausgestalten, um es sozial gerechter zu machen. „Die zehn reichsten Prozent der Menschen sind für 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Wir müssen an die Emissionen dieser zehn Prozent ran“, fordert Zimpelmann. Ärmere Menschen nutzten schon heute öffentliche Verkehrsmittel, weil sie sich ein eigenes Auto nicht leisten können.
Beim dringend notwendigen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel müsse daher die soziale Verträglichkeit mitgedacht werden. „Man muss Politik so gestalten, dass die Menschen sie nachvollziehen, mitgehen und finanzieren können“, resümiert die Forscherin. Skeptisch zeigt sich jedoch DLR-Forscherin Jipp: „Wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, erscheint es wenig plausibel, dass die zu erwartenden Zielverfehlungen des Verkehrs in den nächsten Jahren durch die anderen Sektoren ausgeglichen werden können.“