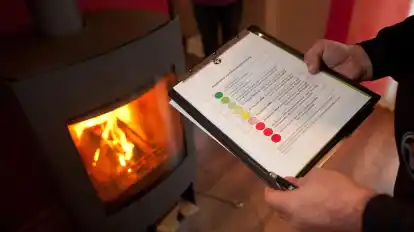Wer es sich in der kalten Jahreszeit gerne vor dem prasselnden Feuer gemütlich macht, sollte den Kalender im Blick behalten: Am 31. Dezember endet eine Übergangsfrist für Kaminöfen, die vor März 2010 in Betrieb gegangen sind. Kann der Besitzer bis dahin nicht nachweisen, dass sein Altgerät bestimmte Schadstoff-Grenzwerte einhält, muss er es stilllegen oder nachrüsten. In Bremen sind Tausende Öfen betroffen – ob ein massenhafter Austausch stattfinden muss, ist bei Experten umstritten.
Was regelt die neue Verordnung?
Die neue Bundesverordnung regelt den maximal erlaubten Ausstoß von Feinstaub (0,15 Gramm) und Kohlenmonoxid (vier Gramm) pro Kubikmeter Abgas. Sie gilt auch für Öfen, die mit anderen Feststoffen wie Pellets oder Hackschnitzeln befeuert werden. Weil beim Bau der Kaminöfen früher weniger Wert auf den Schadstoffausstoß gelegt wurde, schreibt die Verordnung für ältere Geräte eine Nachweispflicht vor. Für Kaminöfen aus den Jahren 1950 bis 1994 besteht sie bereits – zum 1. Januar wird sie in einem letzten Schritt auf die Jahre 1995 bis 2010 ausgeweitet. Neuere Kaminöfen sind von der Verordnung nicht betroffen, gleiches gilt für offene Kamine und Feuerstätten, die als alleinige Wärmequelle dienen.
Wie viele Öfen sind in Bremen betroffen?
Eine Statistik nach Baujahr der Öfen liegt nicht vor. Die Bremer Schornsteinfegerinnung gab die Zahl der Feuerstätten für feste Brennstoffe zuletzt mit rund 41.000 an – darunter 27.000 Kaminöfen. Rechnet man Schätzungen des Bundesumweltministeriums um, dürfte mindestens ein Drittel der Bremer Öfen von der neuen Regelung betroffen sein.
Was heißt das für Betroffene?
Besitzer von betroffenen Kaminöfen müssen tätig werden. Sie können den Nachweis erbringen, dass ihr Kaminofen die Grenzwerte nicht überschreitet. Einige Hersteller haben für ihre Altgeräte eine erfolgreiche Nachprüfung durchgeführt. Unter www.cert.hki-online.de gibt es dazu eine Datenbank. Eine Nachmessung vor Ort ist auch durch den Schornsteinfeger möglich, der grundsätzlich für die Kontrolle der Abgaswerte zuständig ist. Die Kosten liegen, je nach Aufwand, im niedrigen bis hohen dreistelligen Bereich.
Was ist bei zu hohen Werten möglich?
Werden die Grenzwerte überschritten, ist eine Nachrüstung denkbar. Der Bremer Schornsteinfegermeister Marco Gabrielli nennt passive und aktive Filter als grundsätzliche Optionen. Passive Filter sind ihm zufolge günstiger, aber auch wartungsintensiver. Die Filterkassetten müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Aktive Filter sind laut Gabrielli teurer, brauchen aber nach dem Einbau weniger Aufmerksamkeit. Der Feinstaub wird durch elektrostatische Spannung gebunden, weshalb für aktive Filter ein Stromanschluss erforderlich ist. Die Alternative zur Nachrüstung ist ein neuer Kaminofen.
Was raten Experten?
Vor allem Händler und Schornsteinfeger vertreten unterschiedliche Auffassungen. Ein Beispiel ist die Emissionsmessung, die für ein Altgerät lebensverlängernd sein kann. Bernd Hüholt aus der Bremer Kaminland-Filiale rät davon ab. Für eine solche Messung würden schnell 600 Euro fällig, die meisten seiner Kunden seien von dem Ergebnis enttäuscht. Schornsteinfeger Gabrielli hält dagegen. Dass der Schadstoffausstoß früher weniger Beachtung gefunden habe, bedeute nicht zwangsläufig schlechte Werte. Gerade bei hochwertigen Altgeräten lieferten die Messungen oft überraschend gute Ergebnisse.
Was spricht für einen Neukauf?
Aus Sicht von Hüholt und anderen Händlern ist der Neukauf meistens alternativlos. Kaminland schreibt auf seiner Webseite: „Es gibt derzeit leider keine sinnvolle Nachrüstung.“ Für Altgeräte fehlten oft Ersatzteile. Zwar gebe es auch günstige Filter, sagt Hüholt, aber Produkte mit hoher Wirksamkeit seien so teuer, dass sich die Nachrüstung kaum lohne. Gabrielli sieht in dem Werben für neue Geräte vor allem ein Verkaufsinteresse der Händler. Er rät Betroffenen, sich individuell von ihrem Schornsteinfeger beraten zu lassen.
Warum stehen Kaminöfen in der Kritik?
Kaminöfen sind trotz leicht rückläufiger Nachfrage beliebt, gelten aber als Luftverschmutzer. Das Umweltbundesamt rät aus gesundheitlichen und ökologischen Gründen vom Heizen mit Holz ab. Das Bremer Umweltressort bewerte diese Empfehlung positiv, erklärt eine Sprecherin auf Nachfrage. Experten betonen immer wieder, dass häufig nicht nur ein Kaminofen selbst für dicke Luft sorgt, sondern auch die falsche Nutzung. Sie empfehlen, aufbereitetes und getrocknetes Holz aus nachhaltiger regionaler Forstwirtschaft zu verwenden.