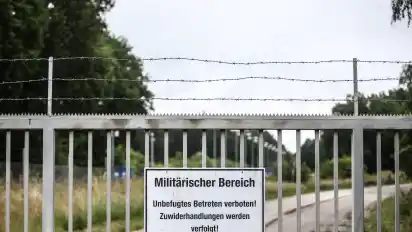Im Grunde sind sich alle einig: Die Schadstoffe, die vom Farger Tanklager über das Grundwasser in Richtung Weser gespült werden, müssen weg. So sagen es Entscheider von Land und Bund. Nur wie und wann, das sagen sie nicht. Weil sie es nach eigenem Bekunden noch nicht können. Zum Unverständnis von Anwohnern und Mitstreitern einer Initiative. Die hat jetzt alle Behördenvertreter, die sich mit den Problemzonen des früheren Militärgeländes befassen, zur Debatte eingeladen. Wie die verlaufen ist und warum manche Fragen unbeantwortet bleiben – ein Überblick.
Der Abriss: Fast alles soll kleingemacht und abtransportiert werden – und was zu groß ist, um es kleinzukriegen, wird verpresst und verfüllt. Stefan Ivert spricht von Teilen der Treibstoffleitungen und Teilen der Tanks. Vor einer Woche hat der Projektleiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das schon einmal gemacht, als Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) zu Besuch auf dem Tanklager-Areal war. Jetzt macht er das vor rund 60 Frauen und Männern, die wissen wollen, wie es mit dem kontaminierten Boden und Grundwasser weitergeht. Ivert sagt, dass die Abrissarbeiten voraussichtlich bis 2027 dauern und 50 Millionen Euro kosten werden. Er nennt sie den Auftakt für eine Baustelle, die gleich im Anschluss folgt und tiefer geht: in die Erde.
Die Bodensanierung: Dass die Bagger jetzt dabei sind, zuerst den zweiten Verladebahnhof auf dem Gelände in Trümmer zu legen und nicht den ersten, hat mit der Schadstoffbelastung zu tun: Sie ist dort größer. So groß, dass die Grube, die gegraben werden muss, um den kontaminierten Boden nach oben zu holen, 6000 Quadratmeter misst. 155.000 Kubikmeter Erde kommen raus und später, wenn sie gereinigt sind, wieder rein. So der Plan. Ob er aufgeht, darüber kann Altlastenmanager Ivert nur spekulieren. Er weiß nämlich nicht, wie erfolgreich das mikrobiologische Verfahren ist, mit dem der Boden sauberer werden soll. Die Tests folgen noch. Ivert rechnet mit Kosten von mindestens 20 Millionen Euro. Und damit, dass die Arbeiten 2024/2025 beginnen. Sie sollen zwei Jahre dauern.
Die Simulation: Wie verhalten sich die Schadstoffe, die von den Verladebahnhöfen ausgehen? Und wie schnell verbreiten sie sich im Boden? Antworten soll ein Strömungsmodell liefern, das jetzt vom Geologischen Dienst eingesetzt wird. Ingenieure wollen wissen, welche Richtung die Kraftstoffe und Kraftstoffzusätze nehmen, die auf dem Lagergelände versickert sind und über das Grundwasser eine Schadstofffahne gebildet haben. Ingenieure wie Sven Jensen zum Beispiel. Der Geologe sagt, dass die Daten wichtig sind, um später die beste Methode für die Sanierung der Fahne zu finden. Und um bestimmen zu können, was passiert, wenn die Entnahme von Grundwasser erhöht oder verringert wird. Etwa beim Brunnen 16, der näher an der kontaminierten Zone ist als jeder andere Trinkwasserbrunnen.
Der Aufruf: Die Sanierer wissen, in welches Gebiet sich Benzole und Additive vom Verladebahnhof ausgebreitet haben. Projektleiter Ivert zeigt eine Karte mit Häusern, die sich in einem gelb markierten Bereich reihen. Das Gelb steht für die Schadstofffahne. Nur ist der Bereich bloß ein ungefährer Bereich. Die Daten über die Fahne stammen von Messstationen, von denen Ivert nicht so viele hat, wie er gerne hätte. Um das Ausmaß des belasteten Grundwassers genauer bestimmen und die Simulation der Geologen besser machen zu können, setzt er jetzt auf die Anwohner. Wenn die ihre Gartenbrunnen für Proben bereitstellen, kann ihm zufolge Zeit und Geld gespart werden. Gepumpt wird sowieso nicht mehr. Bremen warnt längst davor, das Grundwasser in diesem Quartier zu verwenden.
Die Kritik: Viele haben an diesem Abend viele Fragen. Mal geht es ums Vorgehen der Behörden, mal um die Dauer von Prozessen. Und mal um beides zugleich. Zum Beispiel beim Brunnen 16. Anwohner und Mitstreiter der Tanklager-Initiative können nicht verstehen, warum er nicht schon längst stillgelegt und dafür ein anderer mit größerem Abstand neu gebohrt worden ist. Manche finden, dass Bremen trotz Klimawandels mit dem Schutz des Trinkwassers nachlässig umgeht. Bernhard Leferink und Michael Koch finden das nicht. Die Referatsleiter für Bodenschutz und sein Kollege von der Wasserwirtschaft argumentieren, dass die Sanierung kein Kann ist, sondern ein Muss. Und dass die Sicherheit des Brunnens durch Messstationen gewährleistet wird. Seine Leistung ist bis auf Weiteres gedrosselt worden.
Die Forderung: Heidrun Pörtner und Olaf Rehnisch sagen, sich darüber zu freuen, dass beim Tanklager etwas passiert. Noch glücklicher hätte es die Vorsitzenden der Tanklager-Initiative jedoch gemacht, wenn alles schneller gegangen wäre – und künftig gehen würde. Seit zehn Jahren gibt es die Gruppe. Darum würden sie es toll finden, wenn es nicht noch mal so lange dauert, bis nicht nur die Schadstoffquelle, sondern auch die Schadstofffahne weitestgehend beseitigt wird. Sie erwarten deshalb, dass sich Land und Bund parallel kümmern: um Abriss, Bodensanierung und belastetes Grundwasser. Ihnen will nicht einleuchten, warum die Sanierer nicht schon längst einen Ideenwettbewerb gestartet haben, so wie sie es taten, um auf das mikrobiologische Verfahren für die kontaminierte Erde zu kommen.
Der Ausblick: Nach Ansicht von Ivert kümmern sich Land und Bund genau so, wie es Pörtner und Rehnisch fordern: um alles zugleich. Für ihn ist die Bodensanierung schon ein Teil der Fahnensanierung. Schließlich, erklärt er, werden die Arbeiten beim Verladebahnhof dafür sorgen, dass weniger Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Dass noch nicht feststeht, wie und wann es gereinigt wird, erklären Ivert und die anderen Behördenmitarbeiter mit der Simulation, die noch nicht die Ergebnisse liefert, auf die sie warten – eben wohin sich die Schadstoffe bewegen, wenn sich die Verhältnisse im Boden ändern. Erst wenn das feststeht, meinen sie, kann es Klarheit geben, welche Methode die geeignetste ist: Zusätze nach unten ins Wasser zu pumpen, die die Schadstoffe zersetzen. Oder das Wasser nach oben zu fördern, um es dort zu behandeln. So wie es schon beim Verladebahnhof getan wird.