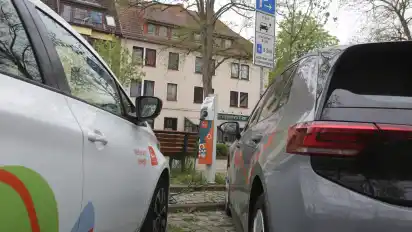Der Hemelinger Bauausschuss hat sich zum wiederholten Mal mit dem Thema Ladesäulen für Elektroautos befasst. In der jüngsten Sitzung sollte es vor allem darum gehen, wie mehr Ladepunkte auf Garagenhöfen und an Mehrparteienhäusern entstehen können, damit auch Hemelinger Bürgerinnen und Bürger, die nicht in Einfamilienhäusern wohnen, Lademöglichkeiten direkt vor der Haustür bekommen.
Diese Zuständigkeiten gibt es
Um ihre Fragen zu klären, hatten die Ausschussmitglieder Martin Palkies vom Vertrieb der Swb eingeladen. Die Swb betreibt in Bremen zum einen öffentliche Ladesäulen, zum anderen sogenannte Wallboxen, also Ladeeinrichtungen für Autos, die in der Regel in Garagen oder Carports installiert werden. Die Swb als ein Stromanbieter von vielen ist für die letzten Meter ab dem Hausanschluss zuständig, Leitungen bis zum Hausanschluss hingegen fallen in den Bereich von Wesernetz als Netzbetreiber.
Das sind die technischen Hürden
Eher organisatorische als technische Hürden gibt es laut Martin Palkies vor allem in dem Bereich zwischen eindeutig öffentlichen Ladepunkten und eindeutig privaten Ladepunkten. "Zum Beispiel Garagenhöfe mit zehn, fünfzehn Garagen und einer Eigentümergesellschaft", sagt Martin Palkies. Wesernetz stelle für eine solche Adresse zwar einen Hausanschluss zur Verfügung, lege aber keine Kabel in die Garagen selbst. Das wiederum bedeutet, dass es eine Art Unterverteilung für mögliche Wallboxen in den Garagen ab dem Hausanschluss geben muss. Hier gibt es dann ein technisches Problem: "Der Hausanschluss hat eine bestimmte Leistung, in der Regel 50 Kilowatt." Wenn mehrere Wallboxen, deren Leistung 11 Kilowatt betragen, laden würden, müsste ein Lastenmanagementsystem eingreifen, um die Last zu verteilen und gegebenenfalls zu drosseln. "Damit wird ein Anschluss teuer", betont Martin Palkies.
Eigentümergemeinschaften müssen sich einigen
An dieser Stelle greift dann ein eher zwischenmenschliches Problem. "Im Moment haben vielleicht zwei, drei Leute von zehn Miteigentümern eines Mehrparteienhauses ein Interesse an einer Wallbox." Sprich: Bevor es zu einem Anschluss kommt, müssen sich Eigentümergesellschaften darauf einigen und klären, wie die Kosten verteilt werden. "Bei fünf oder sechs Interessenten wird es wohl gehen, aber man braucht die Akzeptanz der anderen", sagte Martin Palkies.
Das ist die rechtliche Lage
Grundsätzlich können Wohnungseigentümer laut Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (Wemog) den Einbau einer Lademöglichkeit in der Tiefgarage oder auf dem Gelände eines Mehrparteienhauses verlangen. Die Eigentümergesellschaft kann demnach nur über die Art der Umsetzung mitbestimmen. Die Kosten sind allerdings vom Antragsteller zu tragen, deswegen macht es Sinn, wenn sich mehrere Parteien zusammenschließen und die Ladeinfrastruktur außerdem erweiterbar ist. Nebeneffekt: Immobilien mit Wallbox haben in der Regel einen höheren Marktwert als solche ohne.
Daneben können auch Mieter und Mieterinnen den Einbau einer Wallbox durchsetzen. Diese haben das Recht auf Zustimmung des Vermieters auf eine bauliche Veränderung der "Mietsache", also beispielsweise am mitvermieteten Parkplatz. Ausnahme: wenn der bauliche Aufwand oder die Kosten zu hoch sein würden. Vermieter und Mieter können sich außerdem darauf einigen, wer die Kosten trägt. Trägt der Vermieter diese, kann er die Miete erhöhen.
Wachsender Bedarf
Dass der Bedarf nach Ladesäulen da ist und außerdem wächst, macht der Blick in die Statistik deutlich. Laut Kraftfahrzeugbundesamt wurden im März 2025 insgesamt 1432 Autos in Bremen zugelassen. Davon waren 271 rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge, 591 waren mit einem hybriden Antrieb ausgestattet und 557 Autos waren Benzin- oder Dieselautos. Im März 2024 waren es noch 171 rein elektrische Autos.
Annähernd 70 Prozent aller Märzzulassungen in Bremen sind damit Hybride oder Elektroautos – ein Spitzenwert in Deutschland, an den nur Berlin herankommt. In den meisten Bundesländern bewegt sich die Quote von Hybridautos und reinen Elektroautos zusammengenommen bei den Neuzulassungen bei annähernd 50 Prozent. Offenbar finden die Menschen zunehmend gefallen an der effizienteren und komfortableren Antriebstechnik.
Das sagt der Ausschuss
Für Reinhard Zwilling (FDP) stellte sich die Frage, ob das städtische Leitungssystem überhaupt ausreichend ist für die zusätzlichen Lasten. "Manche Viertel, die sich als erstes Elektroautos anschaffen, werden auch die sein, die als erstes eine Wärmepumpe nachrüsten." Zur Erklärung: Wärmepumpen benötigen zum Betrieb Strom. Für Martin Palkies stellt dies kein Problem dar. "Deswegen müssen Wärmepumpen und Wallboxen angemeldet sein, damit der Netzbetreiber über die möglichen Lasten Bescheid weiß." Außerdem komme hinzu, dass in solchen Quartieren auch als erstes Solaranlagen auf den Dächern entstünden. "Das wäre optimal und entlastet die Netze enorm, wenn tagsüber die E-Autos im Carport mit Strom vom Dach geladen werden."