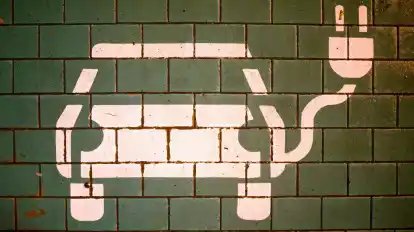- Wie kam es zur Bevölkerungsexplosion?
- Wie verteilt sich die Bevölkerung?
- Wie wird sich die Weltbevölkerung weiter entwickeln?
- Was hat die Trendwende bewirkt?
- Wie erfolgreich war die chinesische Ein-Kind-Politik?
- Ist das Bevölkerungswachstum wirklich problematisch?
„Hurra, die sechste Milliarde ist voll!“, sang Udo Jürgens in den 1990er-Jahren und kritisierte damit zynisch die Verhütungspolitik der katholischen Kirche. Am 12. Oktober 1999 war es tatsächlich so weit. Und 13 Jahre später, am 15. November 2022, knackte die Weltbevölkerung bereits die Schwelle von acht Milliarden Menschen – eine Verdoppelung in knapp 50 Jahren. Auf die Herausforderungen und Probleme, die damit verbunden sind, möchten die Vereinten Nationen seit 1989 mit dem Weltbevölkerungstag am 11. Juli aufmerksam machen.
Wie kam es zur Bevölkerungsexplosion?
Im 20. Jahrhundert entwickelte sich ein exponentielles Wachstum der Bevölkerung. Sicherere Geburten, Antibiotika, Impfstoffe, sauberes Trinkwasser und Ernährungssicherheit durch die landwirtschaftliche Revolution verhinderten vorzeitige Todesfälle und ließen die Lebenserwartung steigen. Allein in den vergangenen 30 Jahren erhöhte sich die globale Lebenserwartung bei Geburt um rund sieben Jahre auf 72 Jahre. Gleichzeitig hingen viele Länder weiter in den alten Mustern fest: Ein Paar muss viele Kinder zeugen, damit genügend überleben, um gemeinsam den Lebensunterhalt der Familie zu bewerkstelligen. Außerdem lehnten viele Menschen nicht zuletzt aus den eingangs erwähnten religiösen Motiven Geburtenkontrolle ab.
Wie verteilt sich die Bevölkerung?
Sechs von zehn Menschen leben heute in Asien, 2,8 Milliarden allein in China und Indien. Jeder sechste Mensch lebt in Afrika, jeder zehnte in Europa. Weitere acht Prozent leben in Lateinamerika, fünf Prozent in Nordamerika und ein Prozent in Ozeanien. Während sich die Fertilitätsrate – die Zahl der Kinder pro Frau – in Asien jedoch inzwischen auf 2,1 Kinder verringert hat, ist sie in Afrika erst auf 4,5 gesunken. Europa liegt bei 1,5. Eine Fertilitätsrate von 2,1 gilt als „Ersatzniveau“, also die Rate, bei der die Bevölkerungszahl konstant bleibt. Auch regional ist die Verteilung ungleichmäßig: Schon heute leben mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten, 2050 könnten es mehr als zwei Drittel sein, schätzen die Vereinten Nationen.
Wie wird sich die Weltbevölkerung weiter entwickeln?
Das Bevölkerungswachstum flacht sich ab und liegt seit Ende der 1980er-Jahre bei rund 80 Millionen pro Jahr. Längerfristige Prognosen hängen jedoch von vielen Variablen ab: Wie verbessert sich die Ernährungssituation, wie entwickeln sich die Frauenrechte, wie stark lassen wir den Klimawandel noch werden und vieles mehr. Die Vereinten Nationen rechnen mit 10,9 Milliarden Menschen im Jahr 2100. Eine aktuelle Studie der University of Washington erwartet hingegen ab 2064 einen Rückgang der Weltbevölkerung auf 8,8 Milliarden Menschen zum Ende dieses Jahrhunderts.
Was hat die Trendwende bewirkt?
Allgemein betrachtet sind die wesentlichen Faktoren der wachsende Wohlstand und zunehmende Bildung auch in ärmeren Ländern. Schaut man auf die Details, kommt man an einer Erkenntnis nicht vorbei: Die zentrale Botschaft des Weltbevölkerungsberichts 2023 der Vereinten Nationen besagt, dass nicht etwa eine politische Steuerung der Geburtenraten ans Ziel führt. Wesentlich wichtiger sei, dass Mädchen und Frauen selbst über ihren Körper und ihre Familienplanung entscheiden können. Zugang zu Bildung ist dabei wichtig, aber noch wichtiger sind die faktischen Selbstbestimmungsrechte. Derzeit hat fast jede zweite Frau auf der Welt diese Freiheiten nicht. Das Bundesentwicklungsministerium stellt daher jährlich mindestens 100 Millionen Euro bereit, um die selbstbestimmte Familienplanung von Frauen zu fördern.
Wie erfolgreich war die chinesische Ein-Kind-Politik?
Von 1980 bis 2016 durften Paare in China nicht mehr als ein Kind zeugen. Die inoffizielle Planzahl lag jedoch immer bei etwa 1,5 Kindern, weil es zum einen Ausnahmen für Minderheiten und wohlhabende Familien gab, zum anderen die Politik insbesondere außerhalb der Städte nie konsequent durchgesetzt werden konnte. Tatsächlich soll die Fertilitätsrate bis 1990 größer als 2 gewesen sein. Die chinesische Regierung geht dennoch davon aus, etwa 300 Millionen Geburten verhindert zu haben. Das Ziel, die Bevölkerung auf 1,2 Milliarden Menschen zu begrenzen, scheiterte aber. Außerdem entstanden soziale Probleme: Es gab mehr verwöhnte Einzelkinder mit weniger Sozialkompetenz. Da weibliche Embryonen oft abgetrieben wurden, entstand ein wachsender Männerüberschuss, der zu mehr problematischem Verhalten junger Männer führte, die unfreiwillig Singles blieben. Nicht zuletzt begann die Gesellschaft zu überaltern. Inzwischen sind wieder drei Kinder pro Paar erlaubt.
Ist das Bevölkerungswachstum wirklich problematisch?
Vor 1800 lebten weniger als eine Milliarde Menschen auf der Erde. Die verfügbaren Ressourcen schienen unbegrenzt, weil ihre Erneuerung den Bedarf überschritt. Mehr Menschen benötigen aber mehr Nahrung, Wasser, Energie und Fläche, verschmutzen mehr Ressourcen und erzeugen mehr Treibhausgase. Trotzdem ist die Bevölkerungszahl nicht das eigentliche Problem: Würden alle Menschen so leben, wie die Deutschen, bräuchten wir schon mit der heutigen Weltbevölkerung die Ressourcen und Regenerationsfähigkeiten von 2,9 Planeten wie der Erde.
Bei US-amerikanischem Konsum wären es fünf Erden, bei indischem hingegen 0,7. Das hat das Global Footprint Network berechnet. Bei den Treibhausgasen gehen 15 Prozent der weltweiten Emissionen zwischen 1990 und 2015 auf das reichste Prozent der Bevölkerung zurück. Die ärmere Hälfte der Menschheit ist insgesamt nur für sieben Prozent der Emissionen verantwortlich, berichtet die Organisation Oxfam. Viele Ökonomieforscher halten daher selbst elf Milliarden Menschen für unproblematisch, sofern diese in einer CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft leben und das Wachstumsdogma aus Zeiten einer ganz anderen Bevölkerungssituation überwunden haben.