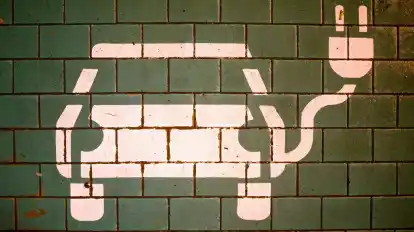- Sind Wasserstoff oder Synfuels eine Option?
- Wie steht es um die Reichweite?
- Wie schnell können Batterien geladen werden?
- Wie entwickelt sich Ausbau der Ladeinfrastruktur?
- Welche Bedeutung haben Batterierohstoffe?
In Wissenschaft und Industrie gibt es keine Zweifel: Die Zukunft des Pkw ist elektrisch. Das hat einen einfachen Grund: Mobilität muss CO2-neutral werden, und das bald. Diese Erkenntnis folgt ebenso aus den völkerrechtlich bindenden Klimaschutzzielen des Paris-Abkommens wie aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum deutschen Klimaschutzgesetz. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden nun jedes Jahr teurer im Betrieb, weil der bis 2026 künstlich gedeckelte CO2-Preis sich gegenüber heute vervielfachen wird. Es ist sogar denkbar, dass ihre Nutzung noch vor 2035 – dem Jahr, ab dem in Europa keine Neuzulassung mehr erfolgen darf –, von Gerichten eingeschränkt wird, wenn Deutschland seine Klimaschutzziele verfehlt. Zahlreiche Hersteller haben bereits angekündigt, sich vom Verbrenner zu verabschieden, die ersten 2024, die letzten spätestens 2035 – mit Ausnahme von Porsche.
Sind Wasserstoff oder Synfuels eine Option?
Bis 2030 wird keine der möglichen Alternativen zur Batterie – Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe – in annähernd ausreichender Menge verfügbar sein. Außerdem benötigen diese Kraftstoffe zwei bis sechs Mal so viel Strom pro gefahrenem Kilometer für die Herstellung, als wenn der Strom direkt ins Fahrzeug eingespeist wird. Angesichts der Tatsache, dass schon der heutige Energiebedarf Deutschlands noch lange nicht durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann, werden diese Kraftstoffe Anwendungen vorbehalten bleiben, bei denen technische Gründe batterieelektrische Antriebe verhindern. Nicht zuletzt deutet der höhere Strombedarf darauf hin, dass batterieelektrische Fahrzeuge deutlich niedrigere Verbrauchskosten haben werden.
Dennoch sind viele Menschen in Deutschland zurückhaltend bei der Kaufentscheidung für ein Elektroauto. Zwar sind Elektroautos schon heute in einigen Fällen über ihre Lebensdauer günstiger als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge, doch die Anschaffungskosten sind oftmals hoch. Und wer nicht über Garage oder Stellplatz verfügt und am Arbeitsplatz keine Lademöglichkeit hat, muss mehr Aufwand betreiben, als es das Tanken von Benzin oder Diesel erfordert. Umfragen zeigen zudem, dass weitere Kritikpunkte Reichweite, Ladedauer und Umweltverträglichkeit der Batterierohstoffe sind. Doch viele dieser Sorgen sind überholt oder werden es bald sein.
Wie steht es um die Reichweite?
Heutige Stadtautos mit Batterien von 50 bis 60 Kilowattstunden erreichen selbst unter widrigen Winterbedingungen Reichweiten von rund 250 Kilometern, Familienautos mit 70 bis 90 Kilowattstunden liegen bei etwa 350 Kilometern – im Sommer deutlich mehr. In der Premiumklasse gibt es Pkw mit Reichweiten um 600 Kilometer. Damit existieren Lösungen für jeden Bedarf – sieht man vom Preis ab. Ein Konzeptfahrzeug von Mercedes kommt bereits auf 1.200 Kilometer, und Fachleute gehen davon aus, dass Batterien mit 100 Kilowattstunden bis zum Ende des Jahrzehnts Reichweiten von 1000 Kilometern in Alltagsfahrzeugen ermöglichen werden. Schon jetzt konzentriert sich die Batterie-Entwicklung weniger auf noch größere Reichweiten als darauf, die Herstellungskosten zu senken. Denn die Batterie ist ein wesentlicher Faktor für den Fahrzeugpreis.
Wie schnell können Batterien geladen werden?
Oberklassefahrzeuge, die mit 350-kW-Technik geladen werden, beziehen in drei Minuten genug Strom für 100 Kilometer. Damit wäre alle 300 Kilometer ein Ladestopp von zehn Minuten erforderlich, mit steigender Effizienz der Fahrzeuge seltener. Kleinere Fahrzeuge mit langsamerer Ladetechnik benötigen entsprechend länger. Allerdings fahren diese Pkw oft kürzere Strecken und lassen sich an normalen Ladesäulen während des mehrstündigen Parkens zu Hause oder bei der Arbeit laden. Zudem stellen immer mehr Supermärkte und Baumärkte Schnellladesäulen auf, an denen kleine Pkw während der Einkaufsdauer komplett auftanken können.
Wie entwickelt sich Ausbau der Ladeinfrastruktur?
In Zentral- und Nordeuropa ist die Versorgung mit Schnellladesäulen bereits sehr gut, Südeuropa beginnt derzeit aufzuholen. In Deutschland wächst allerdings die Zahl der Elektroautos schneller als die Anzahl der öffentlichen Lademöglichkeiten. Fachleute fordern hier, nicht tröpfchenweise, sondern systematisch und breitflächig die Schnelllade-Infrastruktur auszubauen, damit es kein Glücksspiel ist, eine freie Ladesäule zu finden, und damit schon in naher Zukunft die verfügbare Leistung genügt, damit auch Lkw an Autobahnraststätten laden können. Ebenso empfehlen Studien, Arbeitgeber und Einkaufsmärkte stärker in die Pflicht zu nehmen und es Garagen- und Stellplatzmietern einfacher zu machen, ihren Anspruch auf eine Lademöglichkeit gegenüber den Vermietern durchzusetzen.
Welche Bedeutung haben Batterierohstoffe?
Lithium ist der bislang wichtigste Rohstoff. Inzwischen wurden überall auf der Erde größere Vorkommen entdeckt, und technisch ist ein umweltfreundlicher Abbau möglich. Zudem lässt sich Lithium gut aus Altbatterien zurückgewinnen und recyceln, was Rohstoffabhängigkeiten weiter verringert. Mit Natrium-Ionen-Batterien geht aktuell eine Alternative zu Lithium in Serie, allerdings gegenwärtig mit nur halber Energiedichte. Ein anderer Kritikpunkt an Elektroautobatterien sind die Seltenen Erden, vor allem Nickel, Kobalt und Mangan. Sie werden heute teilweise unter problematischen Arbeits- oder Umweltbedingungen gewonnen, können aber zu 90 Prozent recycelt werden. Doch schon jetzt verwenden die größten Batteriehersteller diese Rohstoffe nicht mehr, sondern setzen auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Diese sind obendrein kostengünstiger.