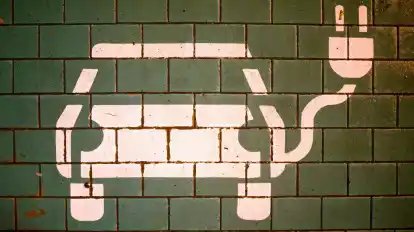- Wie funktioniert das Gedächtnis?
- Wie funktioniert das Vergessen?
- Welchen Nutzen hat das Vergessen?
- Welche Bedeutung hat das Vergessen in der Psychotherapie?
Einen Geburtstag vergessen, nicht mehr wissen, warum man in die Küche gegangen ist, oder gar den Haustürschlüssel nicht eingesteckt haben: Wer etwas vergessen hat, verbindet damit meist etwas Unangenehmes, hat vielleicht Sorge vor einer Demenzerkrankung. Doch das wird dem Gehirn nicht gerecht: Vergessen ist zu allererst eine höchst gesunde, wenn nicht lebenswichtige Funktion.
Wie funktioniert das Gedächtnis?
Das menschliche Gehirn besitzt ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis. Nur wenn eine Erinnerung vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis transportiert wird, kann sie sich festigen und auch viel später wieder abgerufen werden. Psychologen sprechen dabei von Konsolidierung.
Allerdings ähnelt das Gedächtnis nicht etwa einem Tagebuch. Wann immer eine Erinnerung abgerufen wird, wird sie im Kurzzeitgedächtnis aktiviert und anschließend – womöglich verändert – neu im Langzeitgedächtnis abgelegt. Der Fachbegriff dafür lautet Rekonsolidierung. Das Gedächtnis funktioniert somit eher wie eine Textdatei: Wenn wir sie erneut öffnen, bearbeiten und wieder abspeichern, geht der ursprüngliche Inhalt verloren.
Je häufiger eine Erinnerung abgerufen wird, desto stärker vernetzen sich die beteiligten Nervenzellen. Langzeitpotenzierung nennen das Fachleute. Umgekehrt gibt es die Langzeitdepression: Werden zwei vernetzte Nervenzellen unabhängig voneinander aktiviert, wird ihre Verbindung schwächer. Einst leicht abrufbare Assoziationen verblassen. Die biomolekularen Grundlagen dieser Prozesse sind inzwischen gut verstanden.
Wie funktioniert das Vergessen?
Bis heute ist dennoch unklar, ob Erinnerungen, die wir vergessen, tatsächlich gelöscht sind oder uns lediglich der Zugang zu ihnen erschwert ist. Auf Letzteres deutet der Fall der US-Amerikanerin Jill Price hin. Sie kann sich an jeden Tag ihres Lebens genau erinnern, seit sie elf Jahre alt war. Sie weiß Wochentage, Wetter, mit wem sie was in welchem Restaurant gegessen hat. Psychologen testeten in den 1980er-Jahren ihre Behauptung gründlich und fanden sie schließlich bestätigt.
Grundsätzlich scheint das Vergessen eine Form der Rekonsolidierung zu sein. Dabei gibt es eine wichtige Unterscheidung: das semantische Gedächtnis, in dem wir gelernte Fakten abspeichern, und das episodische Gedächtnis, das selbst erlebte Erinnerungen aufbewahrt. Inhalte aus Ersterem lassen sich recht einfach löschen, wie eine Studie von Nikolai Axmacher von der Universität Bochum gezeigt hat. Er ließ die Teilnehmer der Studie sich zunächst zu Porträtfotos die Namen der Personen merken. Bei einer zweiten Sichtung der Fotos sollten die Teilnehmer zu bestimmten Fotos die Namen vergessen. Tatsächlich konnten sie sich später an die betreffenden Namen schlechter erinnern.
Beim episodischen Gedächtnis hingegen ist es schwieriger, Erinnerungen aktiv zu vergessen, weil sie mit Gefühlen verknüpft sind. Trotzdem ist es möglich und kann sinnvoll sein. Das belegt ein anderes Experiment von Axmacher. Im Versuch wurden den Teilnehmern Sätze präsentiert, zu denen sie spontan drei Worte nennen sollten, die ihnen dazu einfielen. Diese Worte sollten sie sich zum jeweiligen Satz merken. Drückte der Satz einen inneren Konflikt aus, konnten sich die Teilnehmer eine Stunde später schlechter an die drei assoziierten Wörter erinnern als bei Sätzen mit neutralem Inhalt. Axmacher vermutet, dass die unangenehmen Sätze verdrängt wurden, um die damit verbundenen negativen Gefühle abzuwehren.
Welchen Nutzen hat das Vergessen?
Generell ist die Rekonsolidierung des semantischen Gedächtnisses wesentlich, um unser Wissen über die Welt aktuell zu halten oder fehlerhafte Informationen korrigieren zu können. Außerdem können negative Erfahrungen oder Erinnerungen so mit der Zeit verschwinden. Die meisten Menschen erinnern positive Ereignisse gut und vergessen leicht das Negative. Für eine ausgeglichene Psyche ist das sehr gesund.
Vergessen ist zudem wichtig für die Wahrnehmung: Was wir sehen oder hören bleibt nur so lange im Kurzzeitgedächtnis, bis der nächste Sinneseindruck ankommt. Sonst würden sich Bilder im Kopf überlagern oder wir könnten eine Klangfolge nicht als solche wahrnehmen. Ein anderes Beispiel sind Laute, die klanglich zwischen B und P liegen: Kleinkinder nehmen diese Unterschiede noch war. Das erwachsene Gehirn hat diese Zwischenlaute „vergessen“, um besser zwischen B und P unterscheiden zu können. Letztlich ist das Vergessen eine Art Spamfilter: Es unterdrückt die Erinnerung an irrelevante Informationen und erleichtert es so, sich auf Wesentliches zu konzentrieren.
Weil beim Vergessen Fehler passieren können, erinnern wir manchmal wichtige Informationen nicht oder assoziieren etwas Falsches – ein Beispiel dafür sind die Freudschen Versprecher: Sie haben nichts mit geheimen Wünschen zu tun, sondern sind schlicht eine Panne des Gedächtnisses.
Welche Bedeutung hat das Vergessen in der Psychotherapie?
In emotionalen Notsituationen arbeitet das Gedächtnis auf Hochtouren. Möglichst viele Details der Situation brennt es sich förmlich ein. Schon winzige Details der Erinnerungen genügen, um die gesamte Situation in voller Intensität erneut zu erleben. Evolutionär ist das sinnvoll, um möglichst schnell auf wiederkehrende Gefahren reagieren zu können. Allerdings liegt darin auch die Ursache posttraumatischer Stressbelastungen: Schon die Farbe eines entgegenkommenden Autos kann die Erinnerung an einen schweren Unfall wachrufen.
Für die Psychotherapie bildet der Mechanismus der Rekonsolidierung die Grundlage, um derartige traumatische Erinnerungen zu behandeln. Beim Extinktionslernen beispielsweise werden Angstpatienten wiederholt mit Angstsituationen konfrontiert, in denen sie dann die Erfahrung machen, dass sich die Ängste nicht bewahrheiten, bis irgendwann die Angsterinnerung überschrieben ist. Bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ist die „Textdatei“ der schlimmen Erinnerung jedoch praktisch schreibgeschützt, weil die damit verbundenen Emotionen so stark sind. Die Forschung arbeitet deshalb kontinuierlich daran, bessere Wege zu finden, diesen Schreibschutz aufzuheben. Große Hoffnungen ruhen auf Methoden und Wirkstoffen, die das Gehirn anregen, neue synaptische Verbindungen zu diesen Erinnerungen zu bilden.