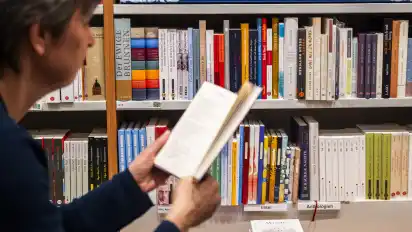Das Gemälde gehört zum eisernen Bestand der Bremer Kunsthalle. Ein zauseliger Mann mit Rauschebart und Knubbelnase sitzt – aus erhöhter Sicht beobachtet – im schwarzen Mantel auf einer Holzbank, die rechte Hand aufs Knie gelegt, und blickt ins Leere. In der linken Hand hält der arme Schlucker zerknitterte Zeitungsseiten, weitere liegen neben ihm. Gemalt hat das Bild Lovis Corinth im Sommer 1902, der damals die Berliner Autoren-Avantgarde in Öl bannte. Der naive Sonderling im Straßenmantel ist der Schriftsteller Peter Hille, der für die Sitzungen 38 Mark erhielt.
Ein Konsul Rosenberg kauft das Bild für 1500 Mark und schenkt es zu Heiligabend seiner Frau. In einer Kurzgeschichte malt sich Hille aus, wie er zu Weihnachten aus seiner Unterkunft geworfen wird, hungrig durch die Stadt irrt und durchs Fenster eines Herrenhauses die Bescherung beim Konsul beobachtet. "Da würde es hergehen, da vorn!", schreibt er. "Wie ich da bewirten mochte, wie mir zu Ehren die gebranntesten Korken sprangen." Der Konsul verkaufte das Bild später an die Kunsthalle Bremen – für 5000 Mark. Aus Freude über den hohen Erlös spendierte er Corinth zwei große Körbe Rotwein. Der veranstaltete für Freunde ein Schlemmermahl. Peter Hille wurde nicht eingeladen.
Das ist nur eine der vielen Begebenheiten, die Dirk Liesemer in seinem Buch "Café Größenwahn 1890-1915" zusammenträgt. Der Journalist erzählt die Geschichte der Kaffeehausliteraten und ihrer Treffpunkte in Wien, München und Berlin. Sie beginnt natürlich in der k. u. k. Hauptstadt an der Donau, im legendären, schon 1897 geschlossenen "Café Griensteidl" am Michaelerplatz. Auf Seite 52 verrät Liesemer, dass die Satirezeitschrift "Figaro" 1893 den Spitznamen "Café Größenwahn" einführte, weil dort seit einigen Jahren die junge Literatenszene ein- und ausging.
Die klammerte sich, ewig klamm, oft den ganzen Tag an eine Melange oder ein Ei im Glas, las Zeitung, rauchte wie die Schlote, diskutierte, trug ihre Texte vor und zog jede Menge neugieriger Besucher an (weshalb die Kellner auch mal die Zeche stundeten): "Unser Hintern fährt dritte Klasse, unser Haupt ragt über die Wolken." Das "Café Größenwahn" strahlte aus und fand geistige Ableger im Münchner "Café Stefanie" und im Berliner "Café des Westens", die denselben Spitznamen erhielten.
Liesemer springt munter zwischen den drei Städten hin und her, wobei sich der Schwerpunkt allmählich nach Berlin verlagert, und verfolgt die wichtigsten Köpfe. In Wien gehört anfangs der früh erfolgreiche Hugo von Hofmannsthal dazu, in den sich der guruhafte Wiener Student Stefan George verliebt (was unerwidert bleibt). Der Mediziner Arthur Schnitzler mit seinen erotischen Skandalstücken. Hermann Bahr, der sich mit Kritiker Karl Kraus fetzt. Der Kurzprosa-Spezialist Peter Altenberg macht das Bohème-Leben zum Beruf, gibt das Café als Postadresse an und wechselt später ins Café Central – das heute noch mit einer Figur am Eingang an ihn erinnert.
In München prägt Bürgerschreck Frank Wedekind das frühe Kabarett und wird sogar zu Festungshaft verurteilt. Die von ihrer Familie verstoßene Husumer Adelige und alleinerziehende Mutter Franziska zu Reventlow, von Rainer Maria Rilke verehrt, schlägt sich am Sendlinger Tor als Mätresse durch, bis eine reiche Heirat winkt. In Berlin kommt der 24-jährige Georg Heym beim Eislaufen um, stirbt Peter Hille, der Dichter vom Gemälde der Bremer Kunsthalle, nach einer kurzen Kabarett-Karriere 1904 an einer Kopfrose. Und die bettelarme Else Lasker-Schüler wandelt als "Prinz von Theben" durchs Kaufhaus des Westens. Neue literarische Formen und Themen, antibürgerliche Moralvorstellungen: Das ermutigt auch Frauen, aus Konventionen auszubrechen.
In kurzen Einschüben lässt Autor Liesemer den Wandel in Politik und Gesellschaft aufblitzen, bis hin zum Ersten Weltkrieg, in dem auch diese Kaffeehauskultur untergeht. Dennoch lebt sein gut recherchiertes Buch vom Anekdotischen. Wer keine anstrengenden Monografien lesen möchte, bekommt einen bunten kulturellen Bilderbogen serviert – und ganz bestimmt Lust auf eine gute Tasse Kaffee.