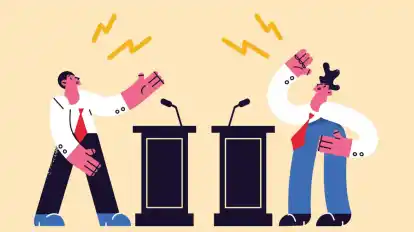Die Bevölkerung stellt hohe Ansprüche an Politikerinnen und Politiker. Die Erwartungen sind umfangreich, auch widersprüchlich: Politiker sollen ihre Linie durchsetzen, aber nicht anecken. Sie sollen schlau und klug sein, sich aber nicht für etwas Besseres halten, weitsichtig vorangehen und das Land für die Zukunft ertüchtigen, aber den Bürgern bloß nicht zu viel abverlangen. Im Grunde soll alles bleiben, wie es ist – nur besser.
„Der Streit ist der Vater aller Dinge; aber der Zank ist ihr Stiefvater (Otto Ernst, Schriftsteller, 1862-1926)“. Was die einen als Ringen um die beste Lösung und als Fundament der Demokratie verstehen, ist für andere politisches Gezänk. Laut Umfragen sind Auseinandersetzungen zwischen denen, die zum Wohle des Landes zusammenhalten sollten, in der Bevölkerung verhasst, selbst wenn sich der eine oder die andere daran heimlich, still und leise ergötzen mag. Mehr noch als für den inhaltlichen Zwist in einem Regierungsbündnis gilt das für parteiinterne Konflikte. Dabei liegen sie in der Natur der Sache. Kandidieren heißt auch fast immer konkurrieren.
Feind, Todfeind, Parteifreund – Helene Bubrowski, Mitglied der Berliner Parlamentsredaktion der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, führt in ihrem Buch „Die Fehlbaren“ aus: „Freundschaften zwischen Politikern sind selten, in der Regel sind es taktische Bündnisse. Sie bestehen auf Zeit, so lange, wie sie beiden Seiten helfen oder zumindest einer. Man muss sich gut stellen mit den Wichtigen, wenn man Karriere machen will. Und die sollte man auch nicht irritieren, indem man mit Parteifreunden verkehrt, die als Querulanten gelten oder gar in Ungnade gefallen sind.“ Mit anderen Worten: Parteiinterne Auseinandersetzungen sind unvermeidlich, wenn man es weiter als bis zum Ehrenamt schaffen will.
Grabenkämpfe und Machtspielchen
Beispiele für Reibereien in den eigenen Reihen gibt es mehr als genug: Konkurrierende Machtansprüche haben die AfD in Bremen die Kandidatur für die Bürgerschaft gekostet. Die Bremer CDU hat ihre Grabenkämpfe um Rita Mohr-Lüllmann und Thomas Röwekamp bis heute nicht ganz verwinden können. Die Hamburger FDP gilt als zerstritten. CDU und CSU machen es sich in der Union gegenseitig nicht leicht. CDU-Chef Friedrich Merz konkurriert mit Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens. Beide wollen Kanzler(kandidaten) werden. Markus Söder hat vor Kurzem (bei Markus Lanz, wo sonst?) abgewunken. Aber falls das Land ihn brauchen sollte ... man kennt das. Die SPD-Parteifreunde Martin Schulz und Sigmar Gabriel galten als Intimfeinde, und Die Linke ringt mit ihrer bekanntesten Genossin, Sahra Wagenknecht.
Politischer Streit ist unverzichtbar, auch parteiintern. Irrtümlich ist häufig von einer Kampfkandidatur die Rede, wenn es mehr als einen Bewerber auf einen Posten wie den des Landesvorsitzenden gibt. Man könnte es auch Bestenauslese nennen, selbst wenn offenbleibt, ob die höhere Qualifikation allein im besseren Netzwerken liegt. Aber stellt sich nur eine oder einer zur Wahl, wird Parteien vorgeworfen, in „Hinterzimmern“ Personalien auszukungeln.
Dass die Bevölkerung wenig von wochenlangen Debatten hält, liegt nicht nur an weitverbreiteter Ungeduld. Manche Entscheidungen brauchen Zeit, um zu reifen, manchmal auch im Streit. Konfliktforscher Rainer Kilb attestiert Politik und Gesellschaft im „Tagesspiegel“ ein „mangelhaftes Umgangsvermögen mit Konflikten“. Sie seien, heißt es in dem Text, „etwas Negatives geworden, verunsichernde Störfaktoren, auf die allgemein mit Verdrängung, Vermeidung, Kleinreden reagiert werde“. Dazu zähle Kilb auch „Nachbarschaftsstreitigkeiten, die vor Gericht landen, und Erziehungsprobleme, die nun die Schulen regeln sollen. Man delegiert Konflikte an Instanzen und hält sich persönlich raus.“
Oliver Nachtwey, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftler, sagt im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“: „Man bräuchte viel mehr Streit – aber substanziellen Streit statt Gezänk um Kleinigkeiten. Niemand streitet beispielsweise mehr darüber, ob die soziale Marktwirtschaft eine gute Sache ist. Viele haben die Vorstellung, dass Konflikte etwas Schädliches seien, ich sehe das genau anders.“ Geführt wurde das Gespräch im Februar 2019. Das Kabinett Merkel IV regierte, im Grunde gegen den Willen von Rot und Schwarz. Schon 2016 hatte das „Handelsblatt“ über die „Große Koalition der Uneinigkeit“ berichtet und getitelt: „Jeder gegen jeden“.
Wenn sich zwei Parteien nicht verständigen können, obgleich sich beide den schmalen politischen Raum namens Mitte teilen, kann es zu dritt eigentlich nur schiefgehen. Der gemeinsame Nenner ist noch kleiner, er schrumpft im Laufe der Regierungszeit weiter, denn spätestens mit Sicht auf den Wahltermin – auf Bundesebene gilt das auch für Landtagswahlen – ist sich jede Partei selbst die nächste. Vor allem bei den Juniorpartnern bestehen oft Bedenken, dass reibungslose Regierungsarbeit allein auf die Partei des Kanzlers einzahlen könnte, der für viele Wählerinnen und Wähler als Kapitän auf dem Schiff Deutschland in stürmischer See gilt.
Dabei war die Geburt der Ampelregierung eine wie aus dem Bilderbuch für Koalitionspartner und Politiker, die es noch werden wollten. Im Futurium (!) in Berlin wurde der Vertrag mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ unterschrieben. Olaf Scholz verwies auf die harmonische Zusammenarbeit am Regierungsprogramm. Bleibe es dabei, „dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit für die Aufgaben, die vor uns liegen“. FDP-Chef Christian Lindner wählte die Worte: „Jetzt beginnt die Zeit der Tat.“
Eine besonders unbequeme Lage
Anderthalb Jahre später räumt Katharina Dröge gegenüber der „Taz“ ein: „In der Ampel wird zu viel gestritten. Die Menschen wollen eine Regierung, die Probleme löst und nicht auf offener Bühne streitet.“ Dröge ist eine der Vorsitzenden der grünen Bundestagsfraktion. Allerdings sind die Grünen in einer besonders unbequemen Lage: Es gibt Streit in den eigenen Reihen und in der Regierung. Kniffliger noch: Um den Streit hier zu vermeiden, muss er da riskiert werden und andersherum.
Der noch wenige Tage amtierende rot-grün-rote Senat in Bremen war sich in größeren und kleineren Fragen uneins, hat öffentlich Streit aber vermieden. Die Methode der Wahl war bislang eher, mehr oder weniger leise auf Distanz zu gehen, bei laut geäußerter größtmöglicher Wertschätzung. Vor der Wahl machten sich einige Sozialdemokraten Sorgen, für Entscheidungen haftbar gemacht zu werden, die nicht in ihren Ressorts getroffen worden sind. Auf den letzten Metern vor dem 14. Mai distanzierten sie sich mal ausdrücklich, mal durch die Blume von grünen Beschlüssen oder Vorhaben. Wer will sich schon allen Ernstes über eine Brötchentaste streiten, die ohnehin überregionale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. „Entscheidet die ,Brötchentaste‘ die Bremen-Wahl?“ (Die Welt, „Brötchentaste first, Weltrettung second“ (Geo), „Bremen-Wahl 2023: Scheitern an der Brötchentaste“ (Spiegel).
„Heute sind sich die Parteien der Mitte über das Wesentliche einig“, fährt Nachtwey in der „Süddeutschen“ fort. Früher hätten Franz Josef Strauß, Herbert Wehner und Heiner Geißler um „Vorstellungen gesellschaftlicher Ordnung“ gerungen. „Der Unterschied zu heute ist das, was Sigmund Freud den ,Narzissmus der kleinen Differenzen‘ genannt hat: Es wird heute umso kräftiger zugepackt, je kleiner die tatsächliche inhaltliche Differenz ist.“ Gewiss, es geht nicht im Jahr 2023 nicht um die Weltordnung, aber mächtige Fragen stehen im Raum: Wie viel Zuwanderung können und wollen sich Europa und Deutschland leisten? Wie groß und radikal müssen die Schritte hin zu mehr Klimaschutz sein? Wie sorgt man für mehr soziale Gerechtigkeit? Themen, die viel zu groß sind für Zänkereien.
Der gepflegte Streit ist der Kern der Demokratie, sofern die Kontroverse nicht um ihrer selbst willen angezettelt, von Respekt getragen wird und ein offenes Ende hat. Sie muss der Mühe wert sein. Denn, so der Großmeister des politischen Streits (meist) mit Niveau, der einstige SPD-Fraktionschef Herbert Wehner (1906-1990): „Wir sind nicht auf die Welt gekommen, damit wir es gemütlich haben.“