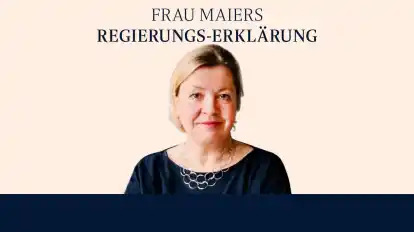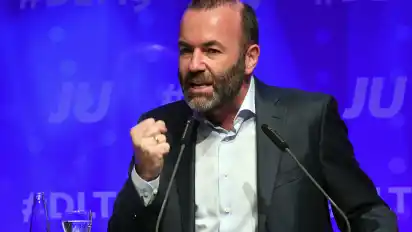- Was muss sich an den Schulen ändern?
- Welchen Stellenwert haben Ausbildungen?
- Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus?
- Welche Rolle soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) einnehmen?
- Wie soll Kultur gestärkt werden?
Am 26. September wählt Deutschland den 20. Deutschen Bundestag. Eine Wahl, die Spannung verspricht und gleichzeitig eine Zäsur ist: Kanzlerin Angela Merkel steht nicht zur Wiederwahl. Wir möchten Ihnen den Überblick zu den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien erleichtern: Dieser Teil beschäftigt sich mit Bildungs-, Medien- und Kulturpolitik und Fragen zur Zukunft von Schulen, Hochschulen und der beruflichen Ausbildung. Außerdem geht es um die Kulturförderung und die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Was muss sich an den Schulen ändern?
CDU/CSU: Aufholen nach Corona steht für die Christdemokraten an den Schulen im Fokus. Dafür wollen sie das bereits aufgelegte Unterstützungsprogramm weiter verfolgen und die Bund-Länder-Initiative "Schule macht stark" ausbauen. Um Lehrkräfte fürs Digitale fit zu machen, sollen bundesweit Bildungskompetenzzentren aufgebaut werden. Medienkompetenz, ein technisches und informatisches Grundverständnis sowie politische Bildung sind der CDU/CSU wichtig.
SPD: Internetzugang und ein digitales Endgerät für alle Schülerinnen und Schüler, das will die SPD in Zukunft umsetzen. Zudem sollen sowohl die Schulgebäude saniert als auch die digitale Ausstattung modernisiert werden. Notwendig seien "Lehr- und Lernmaterialien für inklusive, ganzheitliche Bildung", schreibt die SPD in ihrem Wahlprogramm. Kinder und Jugendliche sollten in Medienkompetenz ausgebildet und individuell gefördert werden. Ein Ganztagsangebot an Schulen soll die Regel werden: So will die SPD gute Chancen für alle sicherstellen.
Bündnis 90/Die Grünen: Jedes Grundschulkind soll Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Dieses Bildungs- und Betreuungsangebot soll in Kooperation mit Vereinen, Musikschulen, Jugendhilfe und weiteren Partnern entstehen. Auch die Schulsozialarbeit soll ausgebaut und auf die psychische Gesundheit der Kinder geachtet werden. Die Grünen wünschen sich "sozial diverse und inklusive Schulen", in denen junge Menschen gemeinsam lernen. Mehr Bewegung, kulturelle und digitale Bildung sollen ebenfalls auf dem Stundenplan stehen.
Die Linke: 100.000 Lehrkräfte und Schulsozialarbeit an jeder Schule wären nötig, um die Situation zu verbessern, meint die Linke. Die Partei fordert mindestens eine Sozialarbeitskraft pro 150 Schülerinnen und Schüler. Außerdem tritt sie für eine Gemeinschaftsschule ein, die ganztägig organisiert ist und an der alle Abschlüsse erworben werden können. Sie soll ohne Hausaufgaben auskommen und demokratisch organisiert sein. Barrierefreie Zugänge und ein Rechtsanspruch auf inklusive Bildung sollen ebenso dazugehören wie ein Laptop für jedes Kind.
FDP: Die Liberalen wollen den Bildungssektor modernisieren und dafür jährlich rund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich investieren. Schulen sollen selbstbestimmter verwaltet werden: Sie erhalten ein frei verwendbares Budget, das sich aus einem Sockelbetrag, Bildungsgutscheinen sowie einem Zuschuss für Kinder mit "niedrigem sozioökonomischem Status" zusammensetzt. Mit "Talentschulen" will die FDP soziale Nachteile überwinden und mit "MakerSpaces" das Interesse der Kinder und Jugendlichen an digitalen Medien und unternehmerischem Handeln fördern.
AfD: Fachwissenschaftliche statt kompetenzorientierte Ausbildung soll nach Willen der AfD an den Schulen künftig im Fokus stehen. Die Partei will Förder- und Sonderschulen erhalten, die "wieder zum Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden" sollen. Islamischer Religionsunterricht soll abgeschafft werden und muslimische Kinder und Jugendliche sollen ohne Ausnahme an Klassenfahrten, Sport- und Schwimmunterricht teilnehmen. "Deutsches Kulturgut" soll verpflichtender Unterrichtsstoff aller Jahrgänge sein.
Welchen Stellenwert haben Ausbildungen?
CDU/CSU: Die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Ausbildung ist der CDU/CSU wichtig. Sie will deshalb "wieder mehr Gewicht auf die Ausbildung junger Menschen als Facharbeiter und Handwerker legen", um den Fachkräftemangel zu beheben. Duale Studiengänge sollen ausgebaut werden, vor allem in den Ingenieur-, Sozial- und Gesundheitswissenschaften, der Informatik und der Betriebswirtschaftslehre. Wer nach einer Berufsausbildung einen Master absolvieren möchte, soll die Möglichkeit haben, BAföG zu erhalten.
SPD: Berufsschulen, vor allem auf dem Land, wollen die Sozialdemokraten mit einem "Pakt für berufsbildende Schulen" stärken. Zentral seien die Modernisierung der technischen Ausstattung und mehr Aufmerksamkeit für den Lehrernachwuchs, heißt es im Wahlprogramm. Unternehmen müssten ausreichend Ausbildungsplätze anbieten. In den Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen soll die Ausbildung nicht mehr vollschulisch, sondern dual sein. So werde möglich, dass die jungen Menschen nicht mehr dafür zahlen müssten, sondern eine Vergütung erhielten.
Bündnis 90/Die Grünen: Mit einer Ausbildungsgarantie wollen die Grünen allen eine Ausbildung ermöglichen und einen erfolgreichen Abschluss unterstützen. Teilqualifikationen sollen bereits während der Ausbildung bescheinigt und Prüfungen in leichter Sprache abgelegt werden können. Eine Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 80 Prozent der durchschnittlichen, tariflichen Ausbildungsvergütung soll Azubis ein eigenständiges Leben ermöglichen. Und mindestens zehn Prozent von ihnen sollen ins Ausland gehen können.
Die Linke: Ausbildungen (auch schulische) sollten nach Willen der Linken kostenlos sein, Azubis sollten mindestens 80 Prozent der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung erhalten. Die Partei fordert, die jungen Leute nach erfolgreichem Abschluss unbefristet und ohne Probezeit zu übernehmen. Die Mitbestimmung der Auszubildenden soll gestärkt werden. Und für die Verbesserung der Lage an Berufsbildenden Schulen wollen die Linken einen Berufsbildungspakt schließen, der für mehr Personal und höhere Qualität sorgen soll.
FDP: Ideen für eine attraktivere berufliche Aus- und Weiterbildung will die FDP in einer "Exzellenzinitiative Berufliche Bildung" sammeln. Grundsätzlich wollen die Liberalen Azubis mehr Zugänge verschaffen: zu Seminaren und Schulungen der Begabtenförderungswerke und Auslandaufenthalten. Bis 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Auszubildenden im europäischen Ausland unterwegs sein können. Der Zugang zu Praktika soll unabhängig von der sozialen Herkunft gewährleistet sein. Außerdem will die FDP die Ausbildungsdauer flexibler gestalten.
AfD: Die AfD will die berufliche Ausbildung stärken, weil das "Streben n
ach immer höheren Abiturientenquoten den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen" gefährde. Konkrete Vorschläge macht sie dazu nicht. Außerdem fordert die Partei, die getrennte Berufsausbildung von Gesundheits-, Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege wieder einzuführen.
Wie sieht die Hochschule der Zukunft aus?
CDU/CSU: Bis 2025 sollen laut CDU/CSU 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden. Mindestens eine der deutschen Universitäten soll in die Top 20 weltweit aufsteigen, die Exzellenzstrategie fortgeführt werden. Die Christdemokraten möchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen bieten und Programme zur Anwerbung ausbauen.
SPD: Mehr Geld - mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung - und breite Förderung sollen die deutschen Hochschulen stärken. Neben Zukunftstechnologien wie Quantentechnik sollen auch Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften gefördert und die Exzellenzstrategie weiterentwickelt werden. Für das Hochschulpersonal will die SPD mehr unbefristete Stellen und verlässliche Karrierewege schaffen. Der BAföG-Anspruch für Studierende soll ausgeweitet und schrittweise ein Vollzuschuss erreicht werden.
Bündnis 90/Die Grünen: Die Grünen wollen bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung investieren, die Grundfinanzierung der Hochschulen anheben und öffentliche Drittmittel für längere Zeiträume vergeben. Die Hochschulen sollen "nachhaltig, klimagerecht und barrierefrei" modernisiert und bürgernäher werden. Für das wissenschaftliche Personal sollen unbefristete Stellen geschaffen und ein Frauenanteil von 40 Prozent festgeschrieben werden. Das BAföG soll zu einer Grundsicherung umgestaltet und erhöht werden.
Die Linke: Die Linke wünscht sich eine "soziale, demokratische, offene und inklusive Hochschule und Wissenschaftslandschaft". Studium und Wissenschaft sollen durch den Bund "flächen- und fächerdeckend" ausfinanziert werden. Sie fordert unbefristete Arbeitsplätze als Norm in der Wissenschaft und einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Eine Frauenquote von 50 Prozent soll außerdem durchgesetzt werden. Studierende sollen ein "rückzahlungsfreies, elternunabhängiges und bedarfsgerechtes BAföG" erhalten.
FDP: An einer neu zu gründenden "European Digital University" soll es in Zukunft möglich sein, sämtliche digitale Lehrangebote der europäischen Hochschulen zu nutzen. Diese Einrichtung soll die "verbleibenden Grenzen der Bildungsmobilität überwinden". Studierende sollen ein elternunabhängiges BAföG in Höhe von 200 Euro - plus 200 Euro für die, die ehrenamtlich engagiert sind oder einer Nebentätigkeit nachgehen - bekommen. Die Förderhöchstdauer liegt bei Regelstudienzeit plus zwei Semester.
AfD: Da sie den Bologna-Prozess und die EU-weite Vergleichbarkeit der Studiengänge für gescheitert erklärt, fordert die AfD eine Rückkehr zu Diplom- und Magisterabschlüssen anstelle der aktuell gültigen Bachelor- und Masterabschlüsse. Hochschulen sollen eine höhere Grundfinanzierung erhalten. Für Studienbewerber soll es Aufnahmeprüfungen geben. Studierende mit Kind sollen die Regelstudienzeit um bis zu sechs Semester verlängern können.
Welche Rolle soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) einnehmen?
CDU/CSU: Die CDU/CSU setzt auf eine Reform des Auftrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der "dem technischen Fortschritt und dem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung trägt". Die Rundfunkanstalten sollen stärkere Kooperationen eingehen, "auch im Sinne der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler". Zeitungen und Anzeigenblätter sollen unterstützt werden, unter anderem mit Geld für das Vertriebssystem. Außerdem wollen die Christdemokraten die Deutsche Welle zum stärksten Auslandssender Europas ausbauen.
SPD: Das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei nötig, um "umfassende und tiefgreifende Berichterstattung" sicherzustellen, schreibt die SPD. Deshalb setzt sie sich für einen starken ÖRR ein. Zugleich wollen die Sozialdemokraten privaten Medienverlagen helfen, die Transformation ins Digitale zu schaffen, unter anderem mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Grundsätzlich wünscht sich die SPD außerdem eine stärkere Vernetzung von Medien-, Bildungs- und Kulturakteuren sowie der Internetgemeinschaft und klassischen Medien.
Bündnis 90/Die Grünen: "Wir stehen zu einem pluralistischen, kritischen und staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk", schreiben die Grünen. Ein gewisser Reformbedarf bestehe, um eine "funktionsgerechte Finanzierung" für einen klar definierten Programmauftrag zu schaffen: "Weil er von allen finanziert wird, muss er auch alle erreichen." Rundfunkräte müssten die Vielfalt der Gesellschaft besser abbilden, sender- und staatsferner sein. Außerdem soll die Digitalisierung vorangetrieben und der Zugang zu den Mediatheken leichter werden.
Die Linke: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehe für "mediale Teilhabe und Grundversorgung", biete journalistische Qualität, Informationen, aber auch Bildung, Unterhaltung und kulturelle Vielfalt, schreiben die Linken im Wahlprogramm. Seine Programmautonomie müsse gewahrt werden und er müsse eine starke regionale und lokale Berichterstattung bieten. Neue ARD-Einrichtungen sollten im Osten angesiedelt werden. Die Partei möchte die Beitragsbefreiungen auf soziale Einrichtungen und Menschen mit Behinderung ausweiten.
FDP: Dem Willen der Liberalen nach soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk "moderner und schlanker" werden: Weniger Fernseh- und Hörfunkkanäle, inhaltlich eine Konzentration auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentationen. Dann soll auch der Rundfunkbeitrag gesenkt werden. Online sollen die Sender ein Angebot machen, das mit dem klassischen Rundfunk vergleichbar ist. "Konkurrenz zu jedem Internet-Angebot privater Presse- und Medienhäuser ist nicht Aufgabe des ÖRR", heißt es im Wahlprogramm.
AfD: Die AfD hält den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner aktuellen Form für "überholt". Nach einer grundlegenden Reform soll nur noch ein Zehntel des aktuellen Angebots übrig bleiben, das sich auf "neutrale Inhalte aus den Sparten Information, Kultur und Bildung" konzentriert. Regionale Sendungen sollen im Sinne eines "Heimatfunks" erhalten bleiben. Die Finanzierung des ÖRR will die AfD vor allem über Abgaben organisieren, die "Technologiekonzerne, die audiovisuelle Inhalte verbreiten, sowie Video-Streaming-Dienste" leisten müssen.
Wie soll Kultur gestärkt werden?
CDU/CSU: Förderprogramme wie "Kultur im ländlichen Raum" oder die Corona-Hilfe "Neustart Kultur" sollen nach Willen der CDU/CSU fortgesetzt werden. Ziel sei es, "das bis zur Pandemie erreichte hohe jährliche Wachstum der Kultur- und Kreativwirtschaft und deren beeindruckende wirtschaftliche Dynamik wiederzugewinnen." Außerdem möchten die Christdemokraten Bräuche und Co. als Ausdruck der kulturellen Vielfalt erhalten. Die Künstlersozialversicherung soll gestärkt und eine Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung geprüft werden.
SPD: In einem bundesweiten Kulturplenum sollen künftig Kommunen, Länder und Bund mit Kulturschaffenden, -verbänden und der Zivilgesellschaft über die Aufgaben und Ziele der Kulturpolitik sprechen. Diese soll außerdem als Staatsziel im Grundgesetz festgeschrieben werden. Mindestgagen und Ausstellungshonorare sollen für bessere Verdienstmöglichkeiten der Kulturschaffenden sorgen. Kommunen sollen Kunst und Kultur aus eigener finanzieller Kraft fördern können, Kinos sollen eine "nachhaltige Finanzierungsbasis" erhalten.
Bündnis 90/Die Grünen: Kultur als Staatsziel im Grundgesetz und Kommunalfinanzen als wichtige Grundlage für das Kulturleben, das sind zwei zentrale Punkte der Grünen. Ein neuer Fonds soll Kultureinrichtungen vor Verdrängung und Abriss schützen. Eine gestärkte Künstlersozialkasse und angemessene Beteiligungen an den Gewinnen der Vertriebsplattformen sollen Kreative finanziell besser dastehen lassen. Bei der Förderung sollen alle Sparten, die freie Szene und feste Einrichtungen gleichermaßen berücksichtigt werden.
Die Linke: Kulturförderung sollte als staatliche Pflichtaufgabe angesehen werden, meint die Linke. Deshalb soll sie zur Gemeinschaftsaufgabe von Kommunen, Ländern und Bund werden. Die Partei fordert zusätzlich ein Bundeskulturministerium. Im Kulturbereich Tätige sollen in die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme einbezogen und ihre Honorare sich an verbindlichen Mindeststandards orientieren. Kulturförderfonds sollen bedarfsgerecht ausgestattet und zum zentralen Instrument der freien Szene werden.
FDP: Die FDP will sich für die Erhöhung des Bundeshaushalts für Kulturförderung im In- und Ausland einsetzen, um Deutschland als "Kulturnation" zu stärken. Kleinere Unternehmen und Solo-Selbstständige in der Kultur- und Kreativwirtschaft sollen Förderungen beantragen können, Anträge sollen vereinfacht werden. Zudem möchten die Liberalen Kultur als Staatsziel im Grundgesetz verankern. Zehn Prozent des jährlichen Budgets öffentlicher und öffentlich geförderter Kulturorganisationen sollen für kulturelle Bildung verwendet werden.
AfD: Kulturpolitische Aktivitäten des Bundes will die AfD mit Verweis auf die Kulturhoheit der Länder begrenzen. Ihr ist es wichtig - neben dem Vorrang der "deutschen Leitkultur" -, den Fokus bei der Erinnerungskultur zu verschieben. Diese dürfe sich nicht nur "auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren", sie müsse auch die "Höhepunkte" im Blick haben. Deshalb verteidigt die AfD das Deutsche Kaiserreich mit seinen Errungenschaften und spricht sich gegen die Kritik an Denkmälern und Straßennamen mit Kaiserreichbezug aus.
Viele weitere Infos gibt es auf unserer Themenseite zur Bundestagswahl.