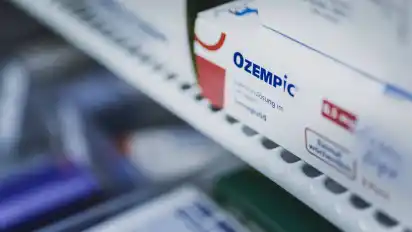- Wann kommt eine Magenverkleinerung infrage?
- Welche Eingriffe zur Magenverkleinerung gibt es?
- Was muss nach der OP beachtet werden?
- Was bedeutet das für die Patienten?
- Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine Magen-OP?
- Folge eines großen Gewichtsverlusts ist häufig überschüssige Haut. Kann diese wieder gestrafft werden?
- Gilt Adipositas als eigenständige Krankheit?
Juli Voß hält ihre kleine Tochter im Arm. Vor gut vier Monaten ist Ronja zur Welt gekommen. Die 40-Jährige ist zu einer Kontrolle ins Rotes Kreuz Krankenhaus (RKK) gekommen. Vor sieben Jahren wurde ihr in der Bremer Klinik für eine Magenverkleinerung ein sogenannter Mini-Bypass gelegt. Juli Voß war stark übergewichtig, wog damals fast 190 Kilo.
"Alles, was ich jahrelang versucht hatte, um deutlich an Gewicht zu verlieren, hat nicht funktioniert. Vielleicht mal ein paar Kilos, die man aber kaum gemerkt hat", erzählt sie. Das extreme Übergewicht – Fachbegriff: Adipositas – hatte bereits zu Erkrankungen wie Bluthochdruck geführt. Ihren Beruf als Altenpflegerin konnte sie wegen des Gewichts und Körperumfang, Atembeschwerden und weiteren Einschränkungen kaum noch ausüben.
Julia Voß ist glücklich, dass sie den Schritt zur Operation vor sieben Jahre gewagt hat. 83 Kilo hat sie nach der Magen-OP abgenommen. "Es ist ein ganz neues Lebens- und Körpergefühl, mit mehr Belastbarkeit, Luft und Selbstbewusstsein – und vielen neuen Möglichkeiten", sagt die 40-Jährige. "Es sind selbst die kleinen Dinge, wie etwa, dass ich in einen Stuhl oder Flugzeugsitz passe, im Freizeitpark die Wasserrutsche benutzen kann", sagt sie. Und: "Der Bluthochdruck ist Geschichte."
Wann kommt eine Magenverkleinerung infrage?
Laut dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG) kommt eine Operation infrage, wenn der Body-Mass-Index (BMI) bei 40 beziehungsweise darüber liegt; oder wenn er zwischen 35 und 40 liegt und zusätzlich andere Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzleiden oder Schlafapnoe bestehen. Julia Voß hatte einen BMI von fast 70. Der BMI berechnet sich laut der Deutschen Adipositas Gesellschaft (DAG) aus dem Quotienten aus Körpergewicht und Körpergröße zum Quadrat (kg/m2). Auf der DAG-Homepage gibt es einen BMI-Rechner (adipositas-gesellschaft.de/bmi/).
Ein Eingriff werde in der Regel erst erwogen, wenn andere Abnehmversuche erfolglos waren – zum Beispiel, wenn ein begleitetes Abnehmprogramm mit Ernährungsberatung, Bewegung und Verhaltensanpassungen keine ausreichende Gewichtsabnahme gebracht haben.
"Bei den Eingriffen steht nicht das Kosmetische im Vordergrund, sondern ganz klar das Medizinische", sagt Alexander Friedemann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am RKK. Früher oder später führe Adipositas zu schweren Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, der wiederum das Risiko für Durchblutungsstörungen und Herzinfarkt erhöht.
Welche Eingriffe zur Magenverkleinerung gibt es?
Die häufigsten Verfahren sind laut IQWIG das Magenband, die Schlauchmagen-Operation sowie der Magenbypass. Als besondere Form gebe es den Mini-Bypass (Omega-Loop-Magenbypass), der auch bei Julia Voß gelegt wurde. Ein Vorteil ist laut Experten, dass die Technik auch bei extrem adipösen Menschen durchgeführt werden könne, dazu kämen eine geringere Operationszeit und verminderte Risiken.
Im Gegensatz zum Standard-Magenbypass wird die Verbindung zwischen dem verkleinerten Magen und dem Dünndarm durch eine einzige Naht geschaffen. Der Dünndarm muss nicht durchtrennt werden. Der Weg der aufgenommenen Nahrung umgeht Teile des Magens, den Zwölffingerdarm und einen Teil des Dünndarms.
Was muss nach der OP beachtet werden?
Vor allem nach einem Magenbypass können Vitamine und Nährstoffe nicht mehr so gut aufgenommen werden. Dies ist auch bei Julia Voß so: "Deshalb muss ich bestimmte Vitamine wie B12 und andere Spurenelemente lebenslang einnehmen", erklärt sie.
Der spürbarste Effekt ist, dass sich schon nach sehr kleinen Mengen ein Sättigungsgefühl einstellt. "Morgens schaffe ich ein halbes, manchmal ein ganzes Brötchen", berichtet die 40-Jährige. "Am Anfang war ich nach zwei Teelöffeln Quark pappensatt. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig." Das früh einsetzende Sättigungsgefühl sei auch eine psychische Herausforderung, betont Chefarzt Alexander Friedemann. "Das Belohnungszentrum im Gehirn ist ja nicht ausgeschaltet."
Was bedeutet das für die Patienten?
Essen müsse neu gelernt werden, weil der Magen nur noch kleine Mengen vertrage. Wer es trotzdem mit größeren Portionen versuche, "riskiert, dass sich Verbindungen auflösen oder ausleiern, Narben aufgehen können", betont der Arzt. "Es kommt sehr auf Disziplin an, ein Leben lang." Daher sei unter anderem eine Ernährungsberatung sowie psychologische Unterstützung nach der OP sinnvoll.
Auch die Wahl der Lebensmittel spielt eine Rolle: Durch eine zu rasche Aufnahme unverdauter Substanzen, vor allem Zucker, könne es zum sogenannten Dumping-Syndrom kommen. Hierbei entleert sich der Magen sturzartig in den Dünndarm: Übelkeit, Erbrechen, Krämpfe, Schwindel und sogar Ohnmacht und Kreislaufkollaps können die Folgen sein.
Julia Voß wiegt durch die Schwangerschaft zurzeit noch 116 Kilo, wie sie sagt. "Das wird sich wieder nach unten bewegen. Mein Ziel ist es, unter 100 Kilogramm zu kommen."
Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten für eine Magen-OP?
Der Medizinische Dienst knüpft mehrere Voraussetzungen an die Kostenübernahme, die bei der Krankenkasse beantragt werden muss. Dazu zählen eine Ernährungsberatung, psychologische Beratung und medizinische Untersuchungen. Die OP muss medizinisch notwendig und andere Behandlungsmöglichkeiten ohne ausreichenden Erfolg versucht worden sein, teilt das IQWIG mit. Kontraindikationen seien etwa eine Drogen- oder Alkoholabhängigkeit sowie schwere psychische Erkrankungen. Patienten müssten zudem die Bereitschaft zeigen, sich auch nach der OP ausreichend zu bewegen und sich gesund zu ernähren. An vielen Kliniken gibt es spezielle Adipositas-Zentren.
Folge eines großen Gewichtsverlusts ist häufig überschüssige Haut. Kann diese wieder gestrafft werden?
"Sobald unsere Tochter aus dem Gröbsten heraus ist, möchte ich das angehen. Vor allem im Bauchbereich gibt es diesen enormen Hautüberschuss", sagt Julia Voß. "Die Hautfalten hängen, sie sind schwer, beim Sitzen und Bewegung ist das extrem hinderlich. Und es ist einfach psychisch belastend." Hinzukomme, dass sich die Haut in den Falten durch Schwitzen und Reibung auch entzünde.
Eine Hautstraffung ist laut Friedemann nicht automatisch Kassenleistung. "Voraussetzung ist eine medizinische Indikation", erklärt der Chefarzt. Wenn etwa schwerwiegende Hautveränderungen wie therapieresistente Pilzinfektionen oder Ähnliches vorliegen, berichtet das Deutsche Ärzteblatt.
Gilt Adipositas als eigenständige Krankheit?
Der Deutsche Bundestag hat im Juli 2020 Adipositas als eigenständige Krankheit anerkannt. "Allerdings begründet das Vorliegen einer anerkannten Krankheit sozialrechtlich nicht automatisch einen Anspruch auf Kostenerstattung", kritisiert die Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG). "Ob und zu welchem Anteil etwa die Kosten für eine Ernährungsberatung oder eine Bewegungstherapie übernommen werden, ist eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Krankenkasse", so die Experten. Die gesellschaftliche Akzeptanz sei "immer noch ein bisschen davon geprägt, dass die Patienten selbst schuld sind", sagt der Bremer Chefarzt. "Adipositas ist eine richtige Diagnose."