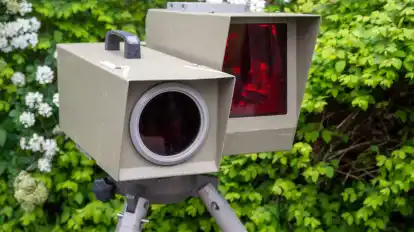Burgdamm. „Die Gästebücher sind eine Fundgrube. “Silvia Claus, Betriebsleiterin beim Beschäftigungsträger „Bras – Arbeit für Bremen“ verweist auf die positiven Reaktionen, die das Hauswirtschaftsmuseum Köksch un Qualm in nunmehr zehn Jahren erfahren hat. Sie empfindet das Angebot auch als einmalig. Auch Ninja Kaupa, ihre Nachfolgerin in der Museumsleitung, ist begeistert über die Mitarbeiter, ihre Entwicklung und die Wertschätzung, die das Köksch un Qualm genießt.
Den Anfang machte das Projekt Mehrgenerationenhaus in der Stader Landstraße 46. Jung und Alt, Paare und Alleinstehende sowie Studenten sollten hier wohnen und nicht anonym nebeneinander, sondern miteinander leben. Darum wurde die alte Tabakfabrik als Beschäftigungsprojekt mit rund 250 Langzeitarbeitslosen umgebaut. Später seien gut 30 Prozent davon in feste Arbeitsstellen vermittelt worden, wurde damals Bilanz gezogen.
Geplant war für den Kellerbereich, dass der Beschäftigungsträger dort Büros für den eigenen Bedarf einrichtet. „Die brauchten wir dann aber nicht“, erinnert sich die damalige Projektleiterin Silvia Claus. Die alte Tabakfabrik Burgdamm als Wiege der Tabakherstellung – es sollte hier etwas entstehen, das an diese Geschichte anknüpft.
Daraus wurde dann das Köksch un Qualm, in dem Hauswirtschaft um 1900 vermittelt wird, im Haushalt eines Tabakfabrikanten mit der historischen Einrichtung. Die Vermittlung übernehmen Langzeitarbeitslose, die bei den Führungen davon erzählen, wie es bei der Familie Richtering damals so war. Die Darstellungen erfolgen in historischen Kostümen. Derzeit arbeiten hier: Acht In-Jobber, zwei über das Bremer Programm Lazlo Beschäftigte, und ein Mitarbeiter hat einen FAV-Vertrag. Dazu helfen ehrenamtliche Kräfte.
Laut Silvia Claus erfüllt das Museum viele Aufgaben: soziale Integration, die Integration in Arbeit, es bietet kulturelle Angebote. Schulklassen und Kita-Gruppen lernen hier auch viel über eine Zeit, die sie nicht mehr kennen. Junge Menschen entdecken hier Gegenstände, die allenfalls noch der Generation ab 50 bekannt ist, weil sie sie bei den Großeltern gesehen hat: Herd oder Bügeleisen, die mit Kohlen betrieben wurden, Waschbrett, andere alte Haushaltsgeräte und eine Einrichtung, die eben historisch ist. Zudem wird Wissen kindgerecht vermittelt.
Große Identifikation
„Auch Ehrenamtliche aus dem Stadtteil werden eingebunden“, ergänzt Ninja Kaupa. Sie erzählt von einer Neubürgerin, die durch die ehrenamtliche Aufgabe Kontakt zu anderen Menschen bekommen hat. Auch frühere In-Jobber, erzählen die beiden, bleiben dem Haus verbunden, als Ehrenamtliche oder sie kommen zu Besuch. Die Identifikation mit dem Museum sei groß.
Das ist positiv und negativ zugleich, denn wie im Vegesacker Geschichtenhaus des Beschäftigungsträgers gilt auch hier: Die Stellen sind befristet. „Diese Aufgabe darf nicht zu einem Lebenszustand werden“, sagt Silvia Claus. Das ist ihr auch am Beispiel einer Mitarbeiterin im Geschichtenhaus wieder bewusst geworden, die verzweifelt ist, weil ihre Stelle ausgelaufen ist. „Sie müssen lernen, Distanz aufzubauen.“ Auch im Köksch un Qualm erhalten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren Rollen als Köchin, Magd, Tabakfabrikant oder Waschfrau vom Publikum „viel Anerkennung“.
Das ist ein nicht zu unterschätzender Wert, der Auswirkungen hat. Es geht nämlich vor allem darum, etwas zu lernen, das hilft, einen Platz in der Arbeitswelt zu bekommen. Ninja Kaupa: „Die Mitarbeiter sollen Fähigkeiten erlernen, die sie später auf ihr Leben übertragen können. Sie sollen gestärkt werden.“ Um beispielsweise selbstbewusst bei Vorstellungsgesprächen auftreten zu können oder herauszufinden, was sie können und wollen.
Zahlen, wie viele Langzeitarbeitslose den Sprung ins Arbeitsleben geschafft haben, gibt es nicht, aber erfolgreiche Beispiele. Eine Mitarbeiterin, die vor ihrer langen Familienzeit als Verkäuferin gearbeitet hatte, macht zurzeit eine Weiterbildung bei der Akademie Überlingen. „Es brauchte Zeit, bis sie sich zutraute, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten“, erzählt Kaupa, „ich habe ihr Aufgaben gegeben, die ihren im Beruf sehr nahe kommen“. Silvia Claus, die diese frühere Mitarbeiterin vor Kurzem zufällig getroffen hat: „Sie ist jetzt glücklich.“
Vor gut einem Jahr übergab Silvia Claus die Verantwortung für das Museum an Ninja Kaupa. Die neue Leiterin hat schnell gespürt, dass sie in einem Kleinod arbeite. Das Köksch un Qualm habe Charme und Charakter, das übertrage sich auch auf die Gäste. Sie meint unter anderem damit, dass Besucher bei den Führungen ins Gespräch kommen, dass sich die Menschen, die etwas für die Einrichtung gespendet haben, immer wieder freuen, das Tischtuch oder den Schrank der Großeltern zu sehen. Im Vergleich zu anderen Museen, in denen sie gearbeitet hat, meint sie: „Dies ist eine eigene Gattung eines kulturellen Ortes.“
Sie hat sich inzwischen verstärkt darum gekümmert, dass die Führungen und das Angebot auch auf Kita-Kinder zugeschnitten wird. Zudem hat sie sogenannte „inklusive Führungen“ entwickelt. Sie sind speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen gedacht, geistiger und körperlicher Art. „Wir sind inzwischen in der Lage, uns auf alle Gruppen einzustellen“, beruft sich Silvia Claus auf die Erfahrungen.
Ninja Kaupa ist überzeugt, dass das Köksch un Qualm ein „Ort mit Daseinsberechtigung bleiben wird“. Für die Generationen, die all das Präsentierte nicht kennen. „Wir müssen uns aber auch auf die neuen Alten einstellen“, sagt sie. Die beiden Frauen ziehen für die vergangenen zehn Jahre Bilanz: „Wir sind für Burglesum zu einer festen Größe geworden.“ Die Weiterentwicklung liegt beiden am Herzen. Ob Kolonialgeschichte oder Migration – Potenzial an Themen, die darstellbar seien, gebe es auf jeden Fall in alle Richtungen.
Weitere Informationen
Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, sich immer donnerstags, 14 bis 18 Uhr, und jederzeit nach Vereinbarung unter Telefon 04 21 / 63 69 58 66 sowie zigarrenfabrik@bras-bremen.de durch das Köksch un Qualm führen zu lassen.