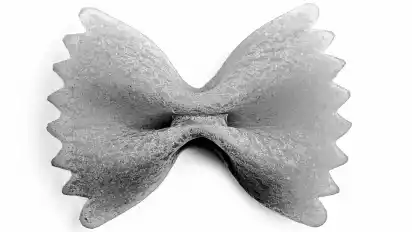Rom. Der Minister war mächtig stolz auf sein Werk. Es gehe um Transparenz für die Verbraucher und darum, die Hersteller von Produkten „Made in Italy“ besser zu schützen. „Wir werden dafür werben, dass dieser Ansatz auf die europäische Ebene übertragen wird“, kündigte Maurizio Martina selbstbewusst an.
Der Mann ist Landwirtschaftsminister in Italien, und seine Einlassungen sind erst wenige Wochen alt. Mitte August hatte die italienische Regierung zwei Verordnungen veröffentlicht, die seitdem nicht nur die Brüsseler EU-Kommission, sondern auch die europäische Nahrungsmittelindustrie und wichtige Handelspartner wie Kanada in Wallung bringen.
Es geht ums Essen. Das ist in Italien bekanntlich eine ernste Angelegenheit und überdies ein Riesen-Geschäft: Künftig muss in dem Land auf Nudel- und Reispackungen vermerkt sein, woher der Hartweizen für die Pasta beziehungsweise der Reis stammen. Auch für Tomatenprodukte sollen bald vergleichbare Vorschriften gelten. Die große Frage ist, ob das mit den Regeln des europäischen Binnenmarkts vereinbar ist – oder ob der Schritt nicht vor allem dazu dient, ausländischen Anbietern das Leben in Italien schwer zu machen.
Italien ist der weltgrößte Pasta-Produzent und beim Reis immerhin die Nummer eins in Europa. Doch die Konkurrenz ist beträchtlich. So fluten etwa türkische Nudelhersteller mit ihren Produkten die lukrativen Märkte in Afrika, Asien und Arabien. Zugleich sind die Hartweizenpreise wegen eines weltweiten Überangebots gesunken, die italienischen Bauern klagen über massive Einnahme-Ausfälle.
Beim Reis stehen die italienischen Produzenten unter Druck, weil zollfreie Importe aus armen Ländern wie Vietnam und Kambodscha die Preise in Europa haben purzeln lassen. Im Geschäft mit Tomaten wiederum sind die Chinesen auf dem Vormarsch. Die italienische Agrar-Lobby fordert bereits seit geraumer Zeit neue Kennzeichnungsvorschriften für den heimischen Markt. Diesem Wunsch kam die Regierung in Rom jetzt bereitwillig nach.
Eigene Produktion deckt Bedarf nicht
Bisher ist es so, dass der Verbraucher in der Regel nicht erkennen kann, ob italienische Nudeln auch aus italienischem Hartweizen hergestellt wurden. Tatsächlich reicht die Produktion der rund 300 000 Weizenbauern im Land auch gar nicht aus, um den immensen Bedarf der Pasta-Hersteller zu decken. Nur etwa 60 Prozent des verarbeiteten Hartweizens kommen aus dem Land selbst. Der Rest muss dazugekauft werden. Größter Lieferant ist Kanada. Bislang müssen die kanadischen Exporteure Zoll auf ihre Lieferungen nach Europa bezahlen, mit dem umstrittenen Handelsabkommen Ceta fiele dies weg.
Verbraucher können auch nicht ohne weiteres erkennen, ob der Risotto-Reis, den ein italienisches Unternehmen vermarktet, aus Bella Italia oder aus dem Ausland stammt. Ebenso bleibt oft im Unklaren, woher die Tomaten in der Dose oder im Konzentrat stammen. Das Kalkül der italienischen Regierung: Wenn einschlägige Ursprungs-Angaben auf die Etiketten gedruckt werden müssen, stärkt das die heimische Agrarproduktion – schließlich sind viele Verbraucher Patrioten, wenn sie am Supermarkt-Regal stehen.
Das Problem ist, dass Italien nicht ohne weiteres eigene Kennzeichnungsregeln für Lebensmittel erlassen kann. Dies ist eine europäische Angelegenheit. Denn wenn es einen gemeinsamen Markt in der Europäischen Union gibt, muss auch für alle Länder verbindlich festgelegt werden, welche Angaben auf Verpackungen zu stehen haben und welche nicht. Die EU-Kommission will noch in diesem Jahr einige neue Leitlinien für die Herkunfts-Kennzeichnung von Lebensmitteln formulieren. Noch ist unklar, wie streng diese ausfallen. Man sehe sich als „Vorhut“ in Europa, sagt der italienische Agrarminister Martina.
Im Milchsektor gestattete Brüssel 2016 einigen Ländern unter dem Eindruck der Milchpreis-Krise, testweise Herkunfts-Labels einzuführen. Unter anderem machen Italien und Frankreich davon Gebrauch. Viele Exporteure halten das für eine schlechte Idee, so brachen beispielsweise Belgiens Milch-Exporte ins benachbarte Frankreich ein.
Die Italiener beschlossen ihre Dekrete zu Nudeln und Reis, ohne sich mit der EU-Kommission abzustimmen. Beobachter betrachten das als Kampfansage. Um dem europäischen Recht Geltung zu verschaffen, müsste die Behörde eigentlich gegen die Regierung in Rom vorgehen, notfalls mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Politisch ist das eine heikle Sache, denn es ginge ja nicht nur gegen den Staat und die Bauernlobby, sondern auch gegen das italienische Lebensgefühl. Im kommenden Frühjahr wird in Italien ein neues Parlament gewählt, und die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung ist in den Umfragen weiterhin stark.
Sprachregelung bei der EU-Kommission ist vorerst, dass man noch Informationen zusammentragen müsse und erst dann entscheiden werde, wie mit den italienischen Dekreten umzugehen sei. Dafür fährt bereits die europäische Lobby der Lebensmittelhersteller schwere Geschütze auf: Die Verordnungen behinderten den Binnenmarkt, heißt es beim Verband FoodDrink Europe. Die Kommission müsse „unverzüglich reagieren“.