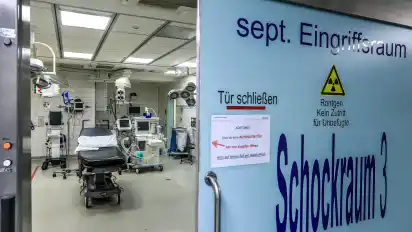Herr Bensch, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat kürzlich vor einer Insolvenzwelle gewarnt, die über die Kliniken hinwegrollen könnte. Wie ernst ist die Lage in Bremen?
Rainer Bensch: Sie ist sehr bedrohlich, das sagen mir alle Gesprächspartner in den Geschäftsführungen der Krankenhäuser. Es fehlt Geld. Was sich derzeit an Kostensteigerungen insbesondere beim Energiebedarf ergibt, ist durch keine Einkünfte gedeckt. Diese Entwicklung kann im schlimmsten Fall binnen Wochen dazu führen, dass man zahlungsunfähig wird. Das dürfen wir aber nicht zulassen. Denn wenn Kliniken schließen müssen, ist die stationäre Gesundheitsversorgung möglicherweise nicht mehr gewährleistet.
Was muss der Bund tun und was kann das Land tun, um Bremens Kliniken zu stabilisieren?
Um erste Hilfe zu leisten, braucht es vonseiten des Bundes einen Inflations- oder Energiepreisausgleich für die Krankenhäuser. Die Bremer Politik muss vor allem ein psychologisches Signal an die Krankenhäuser aussenden, das lautet: Wir lassen euch nicht im Stich. Diese Botschaft kann unter anderem die Form von Landesbürgschaften für diejenigen Häuser annehmen, die finanziell in Bedrängnis geraten sind.
Die städtische Gesundheit Nord (Geno) war schon vor dem Inflationsschock wirtschaftlich angeschlagen. Was läuft dort eigentlich falsch? Schließlich gibt es in Bremen neben der Geno auch freie Kliniken, die ökonomisch deutlich erfolgreicher sind.
Die Geno hinkt vielen Entwicklungen in der stationären Gesundheitsversorgung hinterher. Da haben diverse Gesundheitssenatorinnen und -senatoren, die ja zugleich stets Aufsichtsratsvorsitzende der Geno waren, in der Vergangenheit ihre Arbeit nicht getan.
Was meinen Sie konkret? Fachleute sind sich ja beispielsweise darüber einig, dass es tendenziell deutlich zu viele Betten gibt und man eigentlich auf einen der vier Geno-Standorte verzichten könnte.
Bevor man über die Schließung eines Standortes spricht oder auch nur über größere Umstrukturierungen, muss man den ersten Schritt tun, und zwar eine Bedarfsanalyse für die gesamte medizinische Versorgung im Land Bremen. Sie müsste nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die niedergelassene Ärzteschaft umfassen. Sobald ich weiß, wie der tatsächliche Bedarf der Bevölkerung aussieht und ihn dann mit den vorhandenen Strukturen abgeglichen habe, kann ich politisch steuern.
Aber Hand aufs Herz: Haben alle vier Geno-Standorte eine Zukunft?
Eine solche Aussage kann ich nicht treffen. Vielleicht würde uns eine Bedarfsanalyse ja sogar überraschen. Denn bedenken Sie: 36 bis 50 Prozent der Patienten in den Kliniken der Stadtgemeinde Bremen sind Niedersachsen. Wenn wir also eine Krankenhausplanung hätten, die das Umland einbezieht, würden wir möglicherweise einen ganz neuen Zuschnitt bei den Kliniken bekommen – und das muss dann nicht zwangsläufig heißen: eine Klinik weniger. Wir können allerdings nicht die bestehenden Strukturen um jeden Preis bewahren. Wir brauchen eine Vorstellung von der Medizin der Zukunft und wie sich das Angebot der Kliniken in dieser Richtung verändern muss.
Sie fordern eine grundlegende Bedarfsanalyse, am besten im Zusammenspiel mit Niedersachsen. Die demografischen Daten sind doch eigentlich vorhanden, und auch bestimmte Trends im Gesundheitswesen sind klar erkennbar. Wozu jetzt weitere Gutachten?
Die brauchen wir tatsächlich nicht. Wir haben alle relevanten Daten, man muss sie nur sinnvoll zusammenführen und dann mit Mut einen neuen Kurs einschlagen. Genau das hat bisher nicht stattgefunden.
Innerhalb des Geno-Verbundes ist insbesondere die Zukunft des Klinikums Links der Weser (LdW) offen, weil dort großer Sanierungsbedarf herrscht. Als Optionen stehen ein großer oder kleiner Neubau beziehungsweise die Schließung im Raum, auch eine Sanierung wird derzeit durchgespielt. Was wäre aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung?
Am Beispiel des LdW sieht man, wie man eine Krankenhauspolitik nicht machen sollte. Dort werden ständig neue Vorschläge in die Runde geworfen und dann wieder kassiert, das ist das reinste Chaos. Damit verunsichert man auch die Beschäftigten. So lange man keine fundierte Planung hat, ist es fatal, Kürzungen oder Teilschließungen zu signalisieren. Das gilt gerade für das LdW, in dem es stets eine hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem Standort gegeben hat.
Ein großer Trend in der Krankenhauswirtschaft ist die zunehmende Ambulantisierung. Wo es geht, werden Leistungen nicht mehr stationär erbracht, was auch Kosten senkt. Stellt sich die Geno auf diese Entwicklung bereits ein?
Leider nicht, obwohl dieser Trend seit Jahren erkennbar ist. Das ist nicht nur ein Managementfehler der Geschäftsführung, sondern auch ein politischer Führungsfehler. Senatorin Claudia Bernhard hat offenbar Gestaltungshemmungen. Viele haben gedacht: Mit ihr wird es besser, aber das hat sich leider nicht bewahrheitet. Es werden keine Entscheidungen gefällt, die zukunftsträchtig sind. Es wird nichts unternommen, um die Einnahmesituation nachhaltig zu verbessern.
Aktuell sprechen die Geno- und die freien Kliniken darüber, bestimmte medizinische Behandlungen an einzelnen Häusern zu bündeln, sodass nicht mehr jeder alles anbietet. Dieser Dialog ist aber ins Stocken geraten. Die Bereitschaft der Klinikmanager, sich von Teilen ihres bisherigen Angebots zu trennen, ist offenbar gering. Überrascht Sie das?
Dieser Prozess ist grundsätzlich sinnvoll, aber auch ihm hätte eine gründliche Bedarfsanalyse und eine Gesamtstrategie vorausgehen müssen. Jetzt reden also die Krankenhäuser untereinander – aber was ist mit dem gesamten niedergelassenen Bereich? Die werden überhaupt nicht einbezogen. Ich nenne als Beispiel nur Institutionen wie Kardio Bremen mit ihrem umfangreichen herzmedizinischen Angebot. Der aktuelle Dialog findet ohne sie statt. Das finde ich fahrlässig.
Das vielleicht größte Problem der Krankenhäuser ist der Mangel an Pflegepersonal. Wenn man den nicht in den Griff bekommt, nutzt die beste strategische Neuausrichtung der Bremer Kliniken nichts, oder?
Völlig richtig. Momentan beobachten wir schon, dass Krankenhäuser die medizinischen Fachangestellten aus den Praxen der niedergelassenen Ärzte abwerben. Wir müssen also die Ausbildungskapazitäten deutlich erhöhen und die Rückkehrbereitschaft von Menschen, die sich vom Pflegeberuf verabschiedet haben, fördern. Da lässt sich ein großes Potenzial heben. Es gab kürzlich eine Studie, nach der die Höhe des Verdienstes bei diesen Leuten gar nicht an vorderster Stelle steht. Wichtiger sind Arbeitsbelastung, Betriebsklima, Führungsstil der Vorgesetzten und ähnliche Faktoren. Wir brauchen aber nicht nur Pflegepersonal, sondern auch Ärzte. Und da ist es ein Manko, dass Bremen als einziges Bundesland keine eigene Medizinerausbildung anbieten kann. Wir brauchen die unbedingt. Denn da, wo Universitätsmedizin stattfindet, findet auch der medizinisch-technische Fortschritt statt. Bio-Tech-Firmen und Forschungseinrichtungen für künstliche Intelligenz lagern sich dort an - alles, was die Zukunft ausmacht. Mit einem Medizinstudiengang könnten wir nicht nur etwas für die Sicherung unserer Gesundheitsversorgung tun, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Bremen.