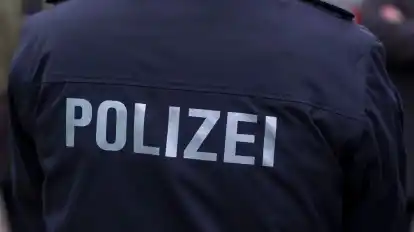Mouhamed Diallo hat sich mächtig über einen Zeitungsartikel geärgert, in dem über die Pläne von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) berichtet wurde, Drogenhändler aus dem Umfeld des Hauptbahnhofes abzuschieben, vornehmlich junge Männer aus Guinea. Darüber müsse man reden, sagt Diallo, der selbst aus dem westafrikanischen Staat stammt. Und stellt dann im Gespräch vorweg zwei Dinge klar: Ja, es stimme, dass einige der Dealer am Hauptbahnhof aus Guinea stammen. Und nein, er finde nicht, dass es rassistisch ist, dies zu sagen. "Wieso, das ist doch die Wahrheit."
Geärgert habe er sich aus einem anderen Grund. "Es ist wahr, aber es tut weh. Es gibt so viele andere von uns in Bremen, die gehen zur Schule, lernen oder arbeiten." Durch die Verbindung zum Drogenhandel entstünde ein falsches Bild von den Guineern, von denen laut Innenbehörde derzeit 645 in Bremen leben. Kaum jemand wisse zum Beispiel, dass es einen guineischen Verein in Bremen gebe, der sich unter anderem darum bemühe, die Flüchtlinge vom Drogenhandel abzuhalten. Und es wisse auch niemand etwas von der Vorgeschichte der jungen Menschen. Auch nicht, wie manche von ihnen dazu kommen, Drogen zu verkaufen.
Ein verlockendes Angebot
Als Diallo 2013 als 16-Jähriger nach Deutschland kam, stand er selbst an einem Scheideweg. Etwa einen Monat sei er in Bremen gewesen, als ihn ein älterer Guineer angesprochen und zum Essen in ein Café unweit des Bahnhofes einlud. Der Mann habe erzählt, dass er selbst schon seit 15 Jahren in Bremen lebt. Und dass alle hier Rassisten seien. "Ich würde niemals eine Chance auf eine gute Zukunft haben." Dann ein verlockendes Angebot: "Ich sollte Drogen verkaufen, um schnell Geld zu verdienen, damit ich mir zurück in Guinea ein Haus kaufen oder ein Unternehmen aufbauen könnte, wenn sie mich wieder aus Deutschland abgeschoben hätten."
Vera Kuenzer kennt solche Geschichten zur Genüge. Sie leitet an der Hochschule Bremen ein Projekt mit dem den Schwerpunkt „Flucht und Migration“. Dazu gehören Gesprächskreise mit Flüchtlingen aus den unterschiedlichsten Ländern. Bei den Treffen mit jungen Guineern wird sie von Mouhamed Diallo unterstützt. "Brückenbauer" wie er seien enorm wichtig und fester Bestandteil des Projekts, sagt sie.
"Niemand kommt, um hier Drogen zu verkaufen", betont Kuenzer. In den Gesprächen würden die Flüchtlinge bewegende, teils unfassbar traurige oder grausame Geschichten erzählen. Die meisten von ihnen erlitten auf der Flucht durch Afrika viel Schlimmeres als das, wovor sie in Guinea geflüchtet waren: Brutale Schlepper, Sklavenarbeit, sexueller Missbrauch und schließlich die oft tagelange Fahrt auf einem überfüllten Schlauchboot übers Mittelmeer. "Wenn wir das gewusst hätten, wären wir lieber arm und ohne Perspektive in Guinea geblieben", habe sie häufiger gehört.
Entsprechend traumatisiert kämen die jungen Menschen nach Bremen. Unsicher, orientierungslos, meist monatelang im Ungewissen darüber, ob sie bleiben dürfen und wie es mit ihnen weitergeht. Hinzu käme der Druck, der Familie zu Hause Geld zu schicken, berichtet Kuenzer. Und genau in dieser Situation würden sie dann von einem Älteren angesprochen, der wie ein großer Bruder auftritt, in ihrer Sprache mit ihnen redet und sich scheinbar um sie kümmert, erläutert Mouhamed Diallo. "Dem glaubst du erstmal alles." Dabei sei dieser große Bruder nichts als ein großer Lügner. "Und das, was er sagt, ist wie ein Virus."
Er selbst sei damals aufgestanden und gegangen, sagt Diallo. "Ich bin Muslim und wurde nicht so erzogen. Warum sollte ich Verbotenes tun?" Mit der Unterstützung einer Pflegefamilie fasste er Fuß in Bremen, lernte Deutsch, bekam ein Stipendium und absolvierte eine Ausbildung. Heute arbeitet der 26-Jährige als Kaufmann im Gesundheitswesen in einem Bremer Krankenhaus. Zusammen mit anderen hat er 2015 den "Guineischer Verein für Integration und Bildung in Deutschland" gegründet, der inzwischen 84 Mitglieder zählt.
Der Verein betreut Flüchtlinge, knüpft Kontakte zu Polizei und Innenbehörde, kurbelt Projekte an... "Wir wollen helfen, denn wir wissen, wie es ist, wenn man hier neu ankommt", sagt Diallo. "Nur sind wir leider oft zu spät." Der Verein würde gerne schon bei der Erstaufnahme von neuen Flüchtlingen aus Guinea von den Behörden herangezogen werden. Man habe dies auch angeboten – ohne Erfolg. "Dabei könnten wir den jungen Leuten gleich am Anfang erklären, wie das Leben hier funktioniert, was auf sie zukommt und welche Möglichkeiten sie haben. Noch dazu in ihrer Muttersprache."
So bleiben manchmal nur Umwege im Nachhinein: Kürzlich sei er mit der Gruppe Guineern, die er betreut, zu den Dealern am Bahnhof gegangen. Denen habe er gesagt, dass die Drogen die sie verkaufen, Menschen krank machen, und dass sie selbst riskierten, durch den Rauschgifthandel im Gefängnis zu landen oder abgeschoben zu werden. Manche hätten darauf aggressiv reagiert, andere aber durchaus zugehört. "Viele wollen da raus. Aber sie wissen einfach nicht wie."