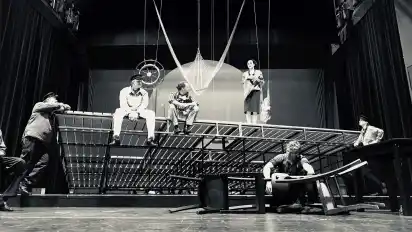Vom Norddeutschen Lloyd ist im neuen Kutscher-Krimi "Transatlantik" erstmals die Rede, als die Mordermittler der Berliner Polizei noch ganz am Anfang stehen. Ein zerknülltes Taschentuch bereitet ihnen Kopfzerbrechen, darauf zu sehen: ein Schlüssel, der mit einem Anker über Kreuz liegt. Für die Beamten offenbar ein Buch mit sieben Siegeln. Was es damit auf sich hat, muss erst mühsam recherchiert werden. "Ist das Symbol des Norddeutschen Lloyd", verkündet schließlich der Kriminalsekretär – "als habe er eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht".
Wer die bislang neun Romane um Kriminalkommissar Gereon Rath – Vorlage für die international erfolgreiche Fernsehserie "Babylon Berlin" – aufmerksam gelesen hat, wird schon vor mehr als zehn Jahren aufgemerkt haben. Im dritten Rath-Roman "Goldstein" heißt es, der gleichnamige US-Gangster sei im Sommer 1931 in Bremerhaven durch den Zoll gegangen – er nutzt also einen Lloyd-Dampfer, um nach Deutschland zu kommen. Vielleicht einen der beiden modernen Schnelldampfer "Bremen" oder "Europa". So ganz überraschend ist das nicht, der Norddeutsche Lloyd gehörte trotz sinkender Passagierzahlen zu den etablierten Marken im Atlantikdienst.
Lloyd-Mitarbeiter betreuten 1936 die Athleten im Olympischen Dorf
Im achten Band "Olympia" taucht die Bremer Reederei dann erstmals unter ausdrücklicher Namensnennung auf. Interessanterweise aber nicht nur als Anbieter transatlantischer Ozeanfahrten. Was wohl nur noch Eingeweihte wissen: Mehr als 180 Köche und 400 Stewards der Reederei bewirteten im Sommer 1936 die Athleten im Olympischen Dorf. Voller Stolz berichtete damals die Bremer Zeitung, aufgrund seiner "jahrzehntelangen Erfahrungen mit ausländischen Gästen" habe der Lloyd die "so wichtige Verpflegung und Bedienung im Olympischen Dorf" übernommen.
Unter den Lloyd-Mitarbeitern im Olympischen Dorf ist der frühere Kommunist Herbert Ehlers, nunmehr ein SA-Mann. Doch dem Überläufer nimmt die Gestapo den Gesinnungswandel nicht ab, die Folterknechte vermuten in ihm ein Mitglied des kommunistischen Untergrunds. Den ungeklärten Todesfall eines Amerikaners sieht die Gestapo als Sabotageakt. Erbarmungslos versuchen die Geheimdienstler, von Ehlers ein Geständnis zu erpressen. Bis er laut Autor Volker Kutscher kurz davor ist, "seine eigene Mutter als kommunistische Verschwörerin zu denunzieren, den Norddeutschen Lloyd als kommunistischen Geheimbund und das Olympische Dorf als dessen Hauptquartier".
In der deutschen Literatur spielen Bremen und Bremerhaven immer mal wieder eine Rolle. Der Schriftsteller Johann-Günther König hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Zwar widerspricht er der gängigen Meinung, Johann Wolfgang von Goethe habe im zweiten Teil seines "Faust" der Gründung Bremerhavens ein literarisches Denkmal gesetzt. Dafür stößt König aber in etlichen anderen Werken auf Spuren des Zwei-Städte-Staats. Bremen und Bremerhaven als Durchgangsstationen nach Amerika nehmen dabei einen relativ prominenten Platz ein. So in dem 1930 publizierten Roman "Hiob" des österreichischen Romanciers Joseph Roth, in dem eine ostjüdische Familie über Bremerhaven nach Amerika auswandert. Kein Wunder, lange Zeit dominierte der Lloyd das Auswanderergeschäft, für Bremen war es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Volker Kutscher siedelt Auftaktkapitel auf dem Schnelldampfer Europa an
Dass Kutscher dem Norddeutschen Lloyd so viel Aufmerksamkeit schenkt, liegt mithin quasi in der Natur der Sache. Doch so prominent wie in "Transatlantik" kam die Reederei in seinen Büchern noch nie zum Zuge. Gleich das Auftaktkapitel siedelt er auf dem Schnelldampfer Europa an: "Kurs Westsüdwest, Zielhafen New York City, Dienstag, 25. August 1936". Danach wechselt die Handlung ins Frühjahr 1937 und endet im Oktober 1937, diesmal ist die "Bremen" der Schauplatz und es geht in umgekehrter Richtung nach Bremerhaven. Kennt der Erfolgsautor denn eigentlich Bremen und Bremerhaven? In Bremen sei er schon häufiger gewesen, so der 60-Jährige gegenüber dem WESER-KURIER. "In Bremerhaven erst einmal, vor einem Jahr etwa."
Im weiteren Verlauf von "Transatlantik" rückt Bremen dann auch direkt ins Blickfeld. Als Charlotte ("Charly") Rath, die vermeintliche Witwe des in Wahrheit nur untergetauchten Kommissars, ihrer ersten wirklich heißen Spur folgt, nimmt sie Telefonkontakt mit dem Norddeutschen Lloyd auf. Genauer gesagt: zur Personalabteilung der Reederei. Sie will sich Klarheit über einen Verdächtigen verschaffen. Im Visier hat sie einen Mann, der in der Berliner Musikkneipe "Groschenkeller" Erkundigungen über das Mordopfer eingezogen hat. Ein "komischer Kauz", der nach Angabe des Wirts "sehr norddeutsch" gesprochen hatte.
So einer muss natürlich nicht unbedingt beim Lloyd arbeiten. Auf den Lloyd bringt sie erst ein Pianist aus dem Groschenkeller, der einmal für "gutes Geld" als Musiker auf dem Schnelldampfer "Bremen" mitgefahren ist und den Mann gleich wiedererkannt hat. "Der Norddeutsche aus dem Groschenkeller war einer der Stewards", sagt er. "Vielleicht sogar einer der Chefstewards." An der Strippe hat Charly dann einen gewissen Asmussen. Von dessen Arbeitsplatz hat sich Kutscher ein Bild gemacht. Er habe sich Fotos angeschaut, "weil ich wissen wollte, in welchem Gebäude Herr Asmussen arbeitet, mit dem Charlotte Rath telefoniert. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll und zeugt vom Selbstbewusstsein des Norddeutschen Lloyd."
Asmussen ist ein wahrhaft norddeutsch klingender Name. Ebenso wie der des dubiosen Oberstewards Hinnerk Ehlers, der als Onkel des misshandelten Herbert Ehlers auf Rache sinnt. Kutscher bestätigt, dass der norddeutsche Einschlag maßgeblich war für seine Namenswahl. "Außerdem mag ich den Namen Hinnerk", sagt er. Hinnerk ist eine norddeutsche Variante von Hinrich oder Heinrich.
Freilich hält Kutscher nicht stur an diesem Prinzip fest. Der Anwalt des SA-Obertruppführers Hinnerk Ehlers heißt Waldemar Heidenreich und kommt aus Bremen-Walle, auch er gehört zur berüchtigten Prügeltruppe. Nordisch ist indessen allenfalls sein Vorname, es gibt aber auch die slawischen Formen Wladimir und Volodymyr. Die Entscheidung für den Bremer Westen als Heimstatt Heidenreichs erklärt der Autor so: "Walle passte ganz gut zum kleinbürgerlich-proletarischen Hintergrund von Hinnerk Ehlers, der seinen Anwalt ja aus der SA kennt."
Ein Blick in das Bremer Adressbuch von 1937 ergibt: Einen Anwalt Waldemar Heidenreich hat es damals in der Stadt nicht gegeben. Ein wenig überraschender Befund, niemand wird das dem Verfasser anlasten wollen. So viel künstlerische Freiheit muss erlaubt sein, schließlich sind auch die meisten Romanfiguren frei erfunden. Sieht man einmal ab von historischen Gestalten wie Konrad Adenauer oder Hermann Göring. Dagegen legt Kutscher bei den Örtlichkeiten großes Gewicht auf wirklichkeitsgetreue Schilderungen. Den "Groschenkeller" gab es wirklich, die Chauffeurs-Kantine gehörte zum weitläufigen Garagenkomplex des Tatorts, war aber auch öffentlich zugänglich. Eine zeitgenössische Ansichtskarte rühmt die etwas verrufene Absteige als das "bekannte Künstler- und Stimmungs-Nachtlokal".
Bremen ist in "Transatlantik" kein Schauplatz
Als Schauplatz kommt Bremen in "Transatlantik" allerdings nicht vor. Kutscher verlegt keinen Handlungsstrang an die Weser, auf eine Schilderung lokaler Sehenswürdigkeiten warten eingefleischte Lokalpatrioten vergebens. Der untergetauchte Kommissar Gereon Rath huscht nicht durch nächtliche Gassen im Stephaniviertel. Kein finsterer Gesell verschafft sich Zutritt zu einem Hafenschuppen, wir müssen ohne die sündige Meile in Walle auskommen. Als Wiesbadener wird man eher auf seine Kosten kommen – in der alten Kurstadt am Rhein lebt Rath incognito. "Das Ufa im Park war eines der modernsten Lichtspielhäuser der Stadt", schreibt Kutscher.
Weil Kutscher auf Bremen als Schauplatz verzichtet, hat er sich auch nicht eigens herbemüht. Eine konkrete Vor-Ort-Recherche sei nicht notwendig gewesen, sagt er. "Außerdem kenne ich die Stadt ja ein bisschen." Dafür hat Kutscher aber Fahrpläne der beiden Transatlantikdampfer "Bremen" und "Europa" aus den Jahren 1936 und 1937 studiert. Die Hapag-Lloyd AG und deren Archivbetreuer H & C Stader hätten ihm dabei sehr geholfen. Um sich visuelle Außen- und Inneneindrücke der beiden Schwesterschiffe zu machen, hat Kutscher im Internet recherchiert. "Es war ein großes Vergnügen, sich diese Fotos anzuschauen, damals sahen Schiffe noch schön aus." Das dürfte auch für den dritten Lloyd-Dampfer gelten, der in "Transatlantik" zu literarischen Ehren kommt: die "Stuttgart", auf der Obersteward Hinnerk Ehlers 1937 auf dem Weg nach Stettin ist.
Was hält Kutscher aber von der Fernsehadaption seiner Romane? Sie nehme sich viele Freiheiten, sagt er, nicht mit allen Änderungen sei er glücklich. "Im Großen und Ganzen aber ist das Projekt gelungen. Man darf die TV-Serie nicht mit der Romanreihe vergleichen und sollte beides unabhängig voneinander betrachten, dann stören einen die Änderungen auch weniger. Was mir wichtig ist: 'Babylon Berlin' nimmt sich desselben Themas an wie meine Romane: Wie schnell eine Demokratie vor die Hunde gehen kann."