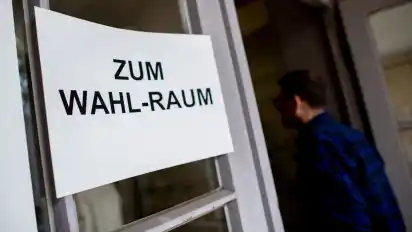Staatsgerichtshof – schon der Begriff klingt sperrig. Und wer als Nichtjurist nachschlägt, mit was sich dieses Gericht so alles beschäftigt, für den wird es nicht besser: Von „abstrakter Normenkontrolle“ ist dann die Rede, von „Interpretationsverfahren“ und von „Organstreit“. Klingt alles andere als bürgernah. Wobei: Einzelne Bürger können vor diesem Gericht ohnehin nicht klagen. Und doch betreffen gerade die Entscheidungen des Staatsgerichtshofes in der Regel alle Bremer Bürger. Wenn es um Gesetze geht, sowieso. Aber auch bei Bürgerbegehren wie zuletzt der Streit um die Platanen am Ufer der Weser.
„Der Staatsgerichtshof ist das höchste Gericht der Freien Hansestadt Bremen“, betont dessen Präsident, Peter Sperlich. Neben Senat und Bürgerschaft ist er eines von drei Verfassungsorganen Bremens. Er fungiert – selbstständig und unabhängig von den beiden anderen – als „Hüter der Verfassung“. Er allein entscheidet, ob Landesgesetze mit der bremischen Verfassung vereinbar sind. Und das schon seit 1949. Zum Vergleich – das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, der oberste Gerichtshof auf Bundesebene, wurde erst zwei Jahre später gegründet.
Dass der Staatsgerichtshof in Bremen schon sehr früh gegründet wurde, geht auf die amerikanische Besatzungsmacht zurück, erläutert Sperlich. Am 17. Juni 1949 wurde das entsprechende Gesetz in der Bürgerschaft beschlossen, im September wählte das Parlament die Mitglieder des Gerichts, im November 1949 wurden sie in der Oberen Rathaushalle vereidigt. Was reibungsloser klingt, als es tatsächlich war. „Damals gab es einen langen Streit, vor allem um die Besetzung des Gerichts“, erläutert Sperlich. Genährt vom allgemeinen Misstrauen gegenüber der Justiz nach deren oft unrühmlicher Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus lautete eine der strittigen Fragen, ob auch ehemalige Mitglieder der NSDAP gewählt werden durften. „Scharfe Debatte um die Kandidaten“, titelte der WESER-KURIER in seiner Ausgabe vom 23. September 1949.
Von der Bürgerschaft gewählt werden die sieben (ehrenamtlichen) Mitglieder des Staatsgerichtshofes bis heute. „Gesetzt“ ist dabei stets der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, wie derzeit Peter Sperlich. Vorgeschlagen werden die Kandidaten von den Parteien, gewählt jeweils für die Dauer einer Legislaturperiode, also vier Jahre, und dies mit einfacher Mehrheit. Damit habe Bremen schon eine „sehr politiknahe Ausgestaltung“ des Staatsgerichtshofes, sagt Sperlich. Vom Streit anno 1949 um die personelle Zusammensetzung sei man heute aber weit entfernt. Von den sechs gewählten Richtern des aktuellen Gerichts wurden jeweils zwei von SPD und CDU vorgeschlagen sowie jeweils einer von den Grünen und den Linken. „Und alle wurden einstimmig gewählt.“ Eine Wiederwahl ist nicht nur möglich, sondern die Regel.
Die Zahl der Verfahren, mit denen sich der Staatsgerichtshof beschäftigt, schwankt. „In den 50-er Jahren waren es mal ein bis drei Verfahren in der gesamten Legislaturperiode“, berichtet Sperlich. „Allein im Jahr 2023 gingen 19 Verfahren bei uns ein.“
Klagen von Abgeordneten
Zwei Dinge sind es vor allem, die das Gericht beschäftigen. Da ist zum einen die sogenannte Normenkontrolle – die Entscheidung, ob ein Gesetz bestehen bleibt oder nicht. Aktuelle Beispiele hierfür sind die Klage der CDU gegen den Klimafonds oder die Klage gleich mehrerer Kammern gegen den Ausbildungsförderungsfonds. Zum anderen die Zulässigkeit von Volksbegehren. Wann immer der Senat ein Volksbegehren ablehnt, weil er es für rechtlich unzulässig hält, muss er diese Entscheidung dem Staatsgerichtshof zur Überprüfung vorlegen.
Hinzu kommen Organstreitigkeiten wie etwa die Klage des Bürgerschaftsabgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) über mangelnde Informationen seitens des Senats oder wie zuletzt, dass ihm die Bürgerschaftspräsidentin das Wort entzog. Hier entscheidet der Staatsgerichtshof, ob tatsächlich gegen seine Rechte als Abgeordneter verstoßen wurde.
Auch Einsprüche beim Wahlprüfungsgericht landen am Ende vor dem Staatsgerichtshof. Und sie waren 2023 die Ursache für gleich mehrere Verfahren, von denen ein Großteil auf die AfD und den Streit über die Wahlvorschläge von deren beider konkurrierenden Landesvorstände zurückging.
Dass einzelne Bürger Landesverfassungsbeschwerde einlegen, ist in Bremen nicht möglich. Vorstellig werden können beim Staatsgerichtshof der Senat, die Bürgerschaft, andere Gerichte oder Körperschaften des öffentlichen Rechts. Andererseits haben Entscheidungen über die Zulässigkeit von Gesetzen oder Volksbegehren natürlich unmittelbare Auswirkungen auf alle Bürger, sagt Peter Sperlich und erinnert an Diskussionen über die Rechtschreibreform, über das Recht auf bezahlbaren Wohnraum, den Pflegenotstand in Bremens Krankenhäusern oder zuletzt die Platanen. „Und da ist dann der Gerichtssaal rappelvoll.“