„Die Wand hier hat mein Mann rausgenommen, jetzt haben wir einen großen Wohnküchenbereich“, sagt Dorothea Meyer und deutet auf die geräumige Essecke: „Da sind jetzt überall Steckdosen.“ Und da könnte irgendwann auch mal ein Pflegebett Platz finden – „damit wir hier bis zuletzt bleiben können“. Sie ist 75, ihr Mann Robert ein Jahr älter, und die beiden wollen auf keinen Fall weg aus ihrem grünen Paradies - der Eigenlandparzelle im Kleingartenverein Nürnberg In den Hufen, einem Gebiet, das zu Findorff gehört. Robert Meyer genießt sogenanntes Auswohnrecht in seinem Kaisenhaus.
Der Begriff geht zurück auf einen Erlass, mit dem der damalige Bürgermeister Wilhelm Kaisen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das Wohnen in Kleingärten legalisierte, um die enorme Wohnungsnot in der zerbombten Stadt zu lindern. Schon 1949 wurde der Erlass wieder aufgehoben, er „wirkt aber bis heute nach“. Die Baubehörde spricht deshalb von „illegal errichteten Behelfsheimen“.
„Wenn man morgens ins Freie geht, steht man im Grünen und hört die Vögel“, sagt Dorothea Meyer. „Man fühlt sich frei. Unsere Töchter konnten hier früher die Musik so laut drehen, wie sie wollten, und haben niemanden gestört.“ Dabei war bis in die 70er- und 80er-Jahre allerhand los in den Blumenwegen, die sich alphabetisch aneinanderreihen: vom Astern- über den Begonien-, Dahlien-, Lilien- und Malven- bis zum Narzissenweg. „Der Orchideenweg gehört schon zum Blockland“, sagt Torsten Laabs. Er ist Meyers Nachbar und Vorsitzender des, wie er sagt, zweitgrößten Kleingartenvereins Bremens: 653 Mitglieder und mehr als 500 Gärten. Mehr als 20 Kaisenhäuser stünden noch auf dem Gelände, neun seien noch bewohnt. „Früher waren das wahrscheinlich 75 Häuser. Der große Schulbus zur Schule Schleswiger Straße war immer voll.“
Im Mai 1948, wenige Wochen vor Robert Meyers Geburt, hatte sich sein Vater mit einem Bäckerladen am Malvenweg selbstständig gemacht. „Erst wollten meine Eltern hier nur wohnen, schließlich entstand dann aber noch die Backstube“, erzählt er. Später hat er hier gelernt und war angestellt, dann, 1980, übernahm er als Bäckermeister zusammen mit seiner Frau den Betrieb: „Ich war der älteste von drei Brüdern, das war einfach so üblich. Aber ich wollte auch nie weg.“

Die großen und kleinen Gartenzwerge wachen seit Jahrzehnten über das grüne Areal der Familie Meyer.
Dorothea Meyer, die aus dem Emsland stammt, erzählt, sie habe vier Wochen nach ihrem Einzug die Aufforderung der Stadt erhalten, „wieder zu verschwinden“, weil sie trotz der Heirat keine Kaisenbewohnerin sei. Ihr Mann habe schließlich den Petitionsausschuss eingeschaltet. „Dann bekam ich eine Duldung.“ Jetzt, 45 Jahre später, findet sie, „dass das eigentlich gar kein richtiges Kaisenhaus ist“, und zeigt auf die Stelle, an der die Wand fehlt und der Raum großzügig im Sonnenlicht erstrahlt. Nichts lässt an einen beengten Behelf oder eine windschief zusammengezimmerte Baracke denken, wie sie nach Kriegsende aus Trümmern errichtet wurden. Aber noch heute wird einmal im Monat die Abwassergrube geleert.
An der Wasserleitung des Vereins hat Robert Meyer als Jugendlicher mitgearbeitet. „Mein Mann ist Handwerker durch und durch“, sagt Dorothea Meyer, die sich bis heute im Verein engagiert und das gute Miteinander schätzt. Bis 2006 haben sie die Bäckerei betrieben. „Früher standen die Leute am Wochenende oft bis zur Straße an. Und ich habe dann mittags manchmal gedacht: Jetzt kann es anfangen zu regnen, dann muss ich nicht noch in den Garten.“ 20 Sauerkirschbäume und Apfelbäume lieferten damals das Obst für Kuchen. Abnehmer gab es allmählich weniger, denn seit kaum noch Kaisenhausbewohner dort zu finden sind, ist außerhalb der Sommermonate nicht mehr so viel los im Parzellengebiet. Auch das hat das Ende der Bäckerei beschleunigt – „und wir hätten einen neuen Ofen gebraucht“.
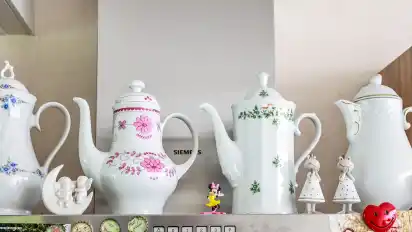
Dorothea Meyers Küche hat mehr Platz bekommen, als die Bäckerei samt Backstube geschlossen wurde.
Wer auf das gelbgetünchte Wohnhaus mit der dicken Fassadenisolierung zugeht und über die Buchenhecke blickt, sieht in die Augen eines riesigen Gartenzwergs. Und entdeckt das Insektenhotel hinter dem großen, alten Süßkirschbaum und die Kinderschaukel der längst erwachsenen Töchter. Wer genau hinschaut oder Robert Meyer fragt, erfährt, dass die Fenster dreifach verglast sind. Die Pelletheizung für das 250-Quadratmeter-Anwesen verursache gerade mal 1000 Euro pro Jahr an Kosten, sagt er. „Das ist alles topp hier.“

Ursprünglich war die Grundfläche klein. Doch in den 40er- und 50er-Jahren wurden viele der Gebäude erweitert.
Der Bäckermeister in Rente genießt es, heute freiwillig früh aufzustehen, um zum Unisee zu radeln oder zu schwimmen. Das ist „neben Häuser reparieren“ seine Leidenschaft. Reisen weniger und Gärtnern schon gar nicht. „Gemüse ist nicht mein Ding.“ Das 1200-Quadratmeter-Areal muss trotzdem beackert werden. Noch recken sich Ackerschachtelhalm, Butterblumen, Gänseblümchen, Löwenzahn und Sumpfdotterblumen keck durchs Gras, aber der Aufsitzmäher steht schon bereit.
Hätte es nicht die Bäckerei gegeben, wäre er „vielleicht Maurer oder Klempner“ geworden. Eine mit viel Eigenarbeit errichtete Doppelhaushälfte in Findorff haben die Meyers schon lange wieder verkauft und gegen eine Wohnung in der Überseestadt getauscht, in der Robert Meyer möglichst alles alleine in Schuss hält. Selbst dort zu wohnen, kommt für ihn gar nicht infrage: „Da wollte ich nicht tot überm Zaun hängen.“

Die alte Süßkirsche vor dem Haus garantiert den Meyers schon morgens einen Blick ins Grüne.






