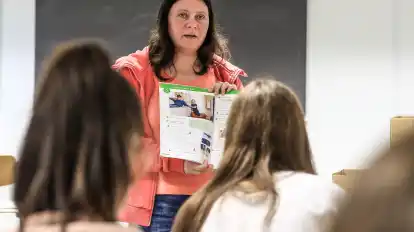Frau Stahmann, Bremen hat längst nicht genügend Wohnraum, um alle geflüchteten Menschen in eigenen Wohnungen unterzubringen. Wie soll das weitergehen? Immer neue Notunterkünfte?
Anja Stahmann: Sie haben Recht, Übergangswohnheime sind immer nur die zweitbeste Lösung, Notunterkünfte nicht einmal die drittbeste. Die Menschen sollen mitten in der Stadtgesellschaft leben, und das geht nun mal am besten, wenn sie eine eigene Wohnung haben. Auf der anderen Seite entsteht ja auch Wohnraum, wenn Sie sich die vielen Bauprojekte in der Stadt ansehen. Ein Drittel aller Wohnungen müssen Sozialwohnungen sein und damit auch erschwinglich für Menschen, die wirtschaftlich noch nicht auf eigenen Beinen stehen.
Sie denken also, es wird möglich sein, dass alle eine eigene Wohnung bekommen werden?
Ja, das wird sicher möglich sein. Wir haben es mit einem unheimlich dynamischen Geschehen zu tun: Sehen Sie sich allein die Bevölkerungswanderung in Bremen an. Rund 31.000 Menschen sind im Jahr 2020 zugezogen und ebenso viele sind fortgezogen. Es sind also rund fünf Prozent aller Wohnungen vorübergehend frei geworden. Da ist auch die eine oder andere dabei, die an Geflüchtete vermietet wird. Man darf auch nicht mit dem Rechenschieber rechnen: Wer in Bremen um Aufnahme bittet, bleibt nicht unbedingt. Wir haben zum Beispiel einen relativ hohen Anteil an Menschen aus den Westbalkanstaaten, die asylrechtlich als sichere Herkunftsländer gelten. Die meisten gehen erfahrungsgemäß wieder zurück in ihre Heimatländer. Auf der anderen Seite: Weil Krieg, Flucht und Migration gesellschaftliche Realität bleiben, müssen wir unser Aufnahmesystem mit eigenen Unterkünften auch in Zukunft weiterentwickeln.
Wie viele Menschen kommen überhaupt noch auf der Flucht nach Bremen?
Es kommen wieder sehr viele Menschen, allein im August waren es 1500. Im März, nach dem Einmarsch von Putins Truppen in der Ukraine, haben wir sogar fast 3000 Menschen aufgenommen. Im ganzen Jahr 2022 waren es bislang über 9000. Auch wenn wir derzeit deutlich mehr als die Hälfte in Bundesländer weiterleiten, die nicht so stark angelaufen sind, werden wir bis zum Ende des Jahres mehr Menschen dauerhaft aufgenommen haben als im Jahr 2016. Und das war nach 2015 bislang das Jahr mit den höchsten Zugängen.
Wie viele waren es damals?
2015 haben wir mehr als 10.000 Menschen aufgenommen, 2016 waren es noch über 3000.
Was die unbegleiteten, geflüchteten Minderjährigen angeht, haben Sie allerdings neulich die Reißleine gezogen. Die Bremer Aufnahmequote sei mehr als dreifach übererfüllt, mindestens 300 Jugendliche würden bis Jahresende sowieso noch erwartet, sagten Sie. Deshalb sei es nun an der Zeit, sie in andere Bundesländer umzuverteilen. Wie leicht oder schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen?
Die Weiterleitung in andere Bundesländer ist eine bundesrechtliche Regelung. Wir hatten sie 2014/2015 eingefordert, Bremen hatte damals mehr Jugendliche als alle fünf neuen Bundesländer zusammen. Damit kommt kein System zurecht. In Zeiten sehr viel geringerer Zugänge in den Jahren danach war das kein Problem mehr. Aber inzwischen sind die Zahlen wieder deutlich gestiegen und wir wissen nicht mehr, wie wir das Wohl der Kinder und Jugendlichen weiter sicherstellen sollen.
Also angesichts der Lage eine leichte Entscheidung?
Es fällt mir schwer, einzusehen, dass ich Minderjährige in Zelten und Turnhallen unterbringen muss, während andere Bundesländer ihre regulären Aufnahmesysteme nicht einmal ausgelastet haben. Die Jugendlichen werden dort viel bessere Bedingungen vorfinden. Insofern finde ich es richtig, dass wir von Anfang an klar signalisieren: In Bremen gelten keine anderen Regeln als überall sonst in der Bundesrepublik.
Die Linke hat sich dagegengestellt, weil sie es nicht für tragbar hält, dass Jugendliche in Handschellen in andere Bundesländer gebracht werden. Ist das tatsächlich so?
Ich will vorweg mal sagen: Bremen erkennt viele junge Menschen als "Härtefälle" an und schließt sie von der Umverteilung aus. Allein mit diesen Entscheidungen liegen wir deutlich über dem Königsteiner Schlüssel, der die Aufnahmequoten unter den Ländern regelt. Das wird auch so bleiben, wir geben diese jungen Menschen ja nicht einmal nach Bremerhaven weiter. An ein anderes Bundesland, in der Regel Niedersachsen, wird nur weitergeleitet, wer so alt und so gefestigt ist, dass man ihm das nach einer langen Reise durch Teile Afrikas, Asiens und durch ganz Deutschland auch zumuten kann. Manchen kann man das nicht zumuten, anderen aber durchaus. Wenn denen aber jemand den Rat gibt: "Ihr braucht nichts zu tun, die können euch nichts", dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie bleiben. Das können wir so nicht hinnehmen, das ist auch nicht im Interesse der jungen Menschen. Wer dem Verteilbescheid nicht aus eigenen Stücken nachkommt, muss deshalb damit rechnen, dass die Polizei in Amtshilfe unterstützend angefordert wird. Und die entscheidet über die erforderlichen Maßnahmen.
Das können dann auch Handschellen sein?
Die Polizei wählt das jeweils mildeste Mittel. Es liegt also vor allem in der Hand der Jugendlichen, wie ihre Umverteilung abläuft.
Wie steht es aus Ihrer Sicht um die Integration der Menschen, die aus der Ukraine nach Bremen gekommen sind? Haben sie es leichter oder schwerer als Menschen aus anderen Ländern?
Ich finde die Frage sehr schwierig. Die Menschen, egal, woher sie kommen, sind aus ganz schlimmen Lebensverhältnissen geflohen. Die meisten befinden sich in einem emotionalen Ausnahmezustand. Da hat es niemand leicht, sich zu integrieren. Was aber stimmt: Die rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Menschen aus der Ukraine sind günstiger. Erstmals in ihrer Geschichte hat die Europäische Union ja die Massenzustrom-Richtlinie – ein scheußlicher Begriff – aktiviert. Das heißt: Anders als alle anderen Geflüchteten haben die Menschen aus der Ukraine direkten Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Aus- und Fortbildung, zu einer eigenen Wohnung. Wer einen Asylantrag stellt, wer sich von Duldung zu Duldung hangelt, hat diese Sicherheiten oftmals über Jahre nicht.
Wie nehmen Sie das Engagement der Bremerinnen und Bremer wahr? Hat sich das im Laufe der Monate seit Kriegsbeginn verändert?
Die große Bereitschaft von Privatleuten, Geflüchtete und Vertriebene aus der Ukraine aufzunehmen, spielt sicher auch eine Rolle für die Integration. Das Engagement ist nach wie vor groß, wenn auch nicht mehr wie in den ersten Wochen. Die menschliche Psyche ist so: Nach dem großen Schrecken am Anfang setzt allmählich die Gewöhnung ein. Das ist auch mit dem Krieg in der Ukraine nicht anders. Zudem ist die Unterstützung öffentlich nicht so wahrnehmbar wie 2014 bis 2016, weil viele Menschen privat untergekommen sind.
Glauben Sie, dass Bremen durch die zusätzlichen Menschen, die hier angekommen sind, an seine Grenzen stößt, zum Beispiel im Bereich Kita- und Schulplätze?
Die Frage nach den Grenzen wird immer wieder gestellt, aber man muss sich vor Augen halten: Was wäre die Alternative? Grenzen dicht? Abschottung? Wir haben in Deutschland die bittere Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wenn kein Land politisch Verfolgte einreisen lassen will. Die Aufnahme ist alternativlos, auch wenn sie mit immensen Herausforderungen für alle Systeme verbunden ist. Nicht nur für mein Haus, das die Menschen in Zusammenarbeit mit einer wahnsinnig engagierten Trägerlandschaft unterbringt, sondern auch für alle nachfolgenden Systeme – Sozialverwaltung, Kita, Schule, Wohnungsmarkt, Gesundheitswesen.
Macht es Ihnen Sorgen, dass es gesellschaftlich zu Spannungen kommt, zum Beispiel im Streit um die ohnehin knappen Kitaplätze? Oder auch in anderen Bereichen?
Ich bin überzeugt, dass wir einerseits eine so hohe Aufnahmebereitschaft mit so viel Verständnis und auf der anderen Seite eine so hohe Flexibilität der Systeme haben, dass solche Neiddebatten nicht die Gesellschaft spalten werden. Und man darf auch nicht unterschätzen: Wer heute eine Kita und eine Schule in Bremen besucht, wird hier vielleicht auch eine Ausbildung machen und irgendwann als Handwerkerin vor der Tür stehen oder als Erzieher die Kinder von morgen betreuen.
Das Gespräch führte Katia Backhaus.