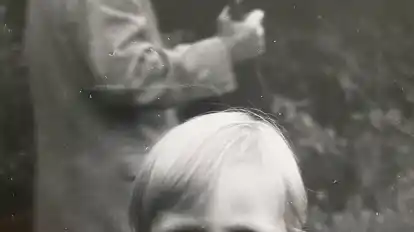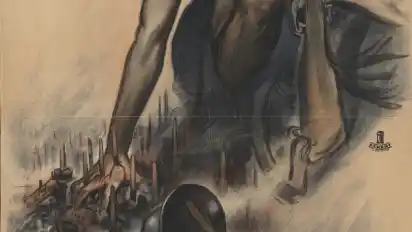Bei einem Glas Rotwein vernahm Theodor Spitta am Abend des 7. Mai 1945 die Nachricht von der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. "Das ist also das Ende des 'Dritten Reichs'", notierte der ehemalige Senator eher ungerührt in seinem Tagebuch. Am gleichen Tag griff auch der Nervenarzt Walther Kaldewey zur Feder. Über die Kapitulation verlor er kein Wort, stattdessen klagte er über Vergewaltigungen durch englische Soldaten. Das Resümee des altgedienten Parteigenossen, der als Leiter der Heil- und Pflegeanstalt Ellen an Euthanasieverbrechen beteiligt war: "Noch bis zum Einzug des Gegners in Bremen herrschte eine tadellose Ordnung."
Für die Weserstadt war der Zweite Weltkrieg schon anderthalb Wochen vor der deutschen Gesamtkapitulation zu Ende. Im Befehlsbunker im Bürgerpark war der letzte Widerstand am 27. April erloschen. Die mehrtägigen Kämpfe samt Artilleriebeschuss kosteten rund 220 Soldaten und 540 Zivilisten das Leben. Darunter Menschen, die bei herrlichem Frühlingswetter nur mal kurz den Bunker verlassen hatten und von einer Granate zerfetzt wurden. Ebenfalls unter den Opfern: jubelnde Zwangsarbeiter, die irrtümlich ins Fadenkreuz eines Tieffliegers geraten waren. Als Spiegelbild des Kampfes um Deutschland bezeichnete Spitta den Kampf um Bremen – "ohne Hoffnung auf Erfolg, ebenso sinnlos und verhängnisvoll".
Doch nun war das Ende des Schreckens in Sicht. Ab dem 8. Mai, 23.01 Uhr, sollten die Waffen schweigen. Die Kapitulationsurkunde hatte Generaloberst Alfred Jodl am 7. Mai um 2.41 Uhr im französischen Reims unterzeichnet. Was im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte besiegelt wurde, fand allerdings nicht den ungeteilten Beifall Josef Stalins. Obschon auch ein russischer General in Reims unterschrieben hatte, bestand der Sowjetdiktator auf einer Wiederholung am 8. Mai in Berlin. Die Zeremonie in der Reichshauptstadt verzögerte sich, erst kurz nach Mitternacht setzte Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel – ein Mann mit Bremer Vergangenheit – seine Unterschrift auf das Dokument. Aber nicht deshalb, sondern wegen der Zeitverschiebung feiert Russland bis heute den 9. Mai als "Tag des Sieges".
Damit ging zumindest in Europa ein beispielloses Blutvergießen zu Ende. Nur im Fernen Osten tobte der Krieg noch monatelang weiter, erst im September 1945 kapitulierte auch Japan. Weltweit kamen im Zweiten Weltkrieg rund 65 Millionen Menschen ums Leben. Die mit Abstand meisten Toten verzeichnete mit 27 Millionen die Sowjetunion, auf deutscher Seite waren es 6,5 Millionen, davon 17.500 aus Bremen. Mit der deutschen Kapitulation war der Griff nach der Weltmacht auch im zweiten Anlauf gescheitert. Und diesmal endgültig, die totale Niederlage war nicht zu beschönigen. Anders als nach dem Ersten Weltkrieg konnte keiner behaupten, das deutsche Heer sei "im Felde unbesiegt" geblieben.
Ungeachtet des millionenfachen Judenmords überwog in Deutschland viele Jahre eine beinahe melancholische Perspektive auf den Tag der Kapitulation. Lange Zeit sprach man vom "Zusammenbruch", wenn die Rede darauf kam. Dieses Wort benutzte Spitta schon am 2. Mai in seinem Tagebuch. Und ganz selbstverständlich auch Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk. Der leitende Minister der Geschäftsführenden Reichsregierung in Flensburg verwendete es, als er am frühen Nachmittag des 7. Mai die bevorstehende bedingungslose Kapitulation im Rundfunk verkündete. Aus "dem Zusammenbruch aller physischen und materiellen Kräfte" habe die Regierung die Folgerung ziehen und den Gegner um Einstellung der Feindseligkeiten ersuchen müssen.
Aus der deutschen Bevölkerung sind zahlreiche konsternierte Reaktionen überliefert. Eine davon stammt von der Bremerin Adele Wieting. "Nun ist der Traum von einem Sieg aus und vorbei, das deutsche Volk wird untergehen", so die 52-Jährige am 12. Mai 1945. Die gläubige Nationalsozialistin Magret Rehm aus Delmenhorst wollte die Niederlage noch nicht einmal wahrhaben, als ihre Heimatstadt schon besetzt war. Am 28. April brachte sie diese Zeilen zu Papier: "Ich kann und will den Gerüchten nicht glauben, soll denn auch dieser Krieg verloren sein? Sechs Jahre sollen wir umsonst gelitten, geopfert und durchgehalten haben im festen Glauben an den Sieg?"
Sogar vom Vorzeige-Liberalen Spitta sind höchst irritierende Äußerungen bekannt. Merkwürdig genug, dass der feinsinnige Intellektuelle Hitler mit Alexander dem Großen und Napoleon verglich. Und auch nichts dabei fand, sich die NS-Terminologie zu eigen zu machen. "Wir können nur wünschen, daß der Führer nicht lebend in die Hand der Feinde fällt und diese letzte Schmach Deutschland erspart bleibt", vertraute er seinem Tagebuch am 28. April an. Vier Tage später reagierte Spitta dann geradezu betroffen, als die Todesnachricht eintraf. "Das Ableben Hitlers geht mir nach", bekannte der 72-Jährige.
Seine Bilanz der NS-Herrschaft ergab zwar ein "erschütternde(s) Bild", weil Hitler praktisch in jeder Hinsicht das genaue Gegenteil seiner eigentlichen Ziele erreicht habe. So habe Hitler dem deutschen Namen zu allgemeiner Achtung verhelfen wollen. Das Ergebnis sei aber, "daß wir wegen unmenschlicher Handlungsweisen gegen Juden, Polen und andere Besiegte mit Schuld beladen dastehen". Doch praktisch im gleichen Atemzug stellte Spitta fest, Hitler habe eine "Austilgung des Judentums in Deutschland, möglichst auch in Europa" angestrebt. Ergebnis sei, dass "das Judentum überall zu großem Einfluß kommt und besonders in Deutschland viele leitende Stellen in Staat, Wirtschaft und Kultur einnehmen" werde.
Aber schon damals gab es auch andere Stimmen. Stimmen wie die des Spitta-Freundes Friedrich Nebelthau, bis 1933 Bremer Gesandter in Berlin. "Das Gefühl der Schmach, ein Deutscher zu sein, liegt nun hinter mir", frohlockte der 81-Jährige am 8. Mai in seinem Tagebuch. Sein Urteil über die zurückliegenden Jahre: "Die Regierung des Dritten Reiches war nie eine Sache des Volkes, sondern von Anfang nur der Partei." Hemmungslos habe sich die NSDAP immer weiter von Recht und Gerechtigkeit entfernt "und scheute vor keinem Unrecht und keinem Verbrechen zurück". Freilich begegnen wir in seinen Worten auch dem Popanz der Parteiherrschaft, der Mär vom verführten Volk.
Dass der Tag der Kapitulation zumindest im doppelten Sinne verstanden werden könnte, gab Theodor Heuss schon am 8. Mai 1949 zu bedenken. Als der Parlamentarische Rat in Bonn das Grundgesetz beschloss, erklärte der spätere erste Bundespräsident, dieser 8. Mai 1945 sei so etwas wie "die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte". Seine Begründung: "Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind." Wobei anzumerken ist, dass Heuss selbst dazu beigetragen hatte, Hitler den Weg zu ebnen. Als Reichstagsabgeordneter der Deutschen Staatspartei hatte er im März 1933 dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt.
Doch es sollte noch bis zum 40. Jahrestag der Kapitulation dauern, ehe sein Nachfolger Richard von Weizsäcker jene Worte fand, die im kollektiven Gedächtnis der Deutschen haften blieben. "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung", stellte das Staatsoberhaupt 1985 in seiner viel beachteten Rede im Bundestag lapidar fest. "Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft." Eine Feststellung, die Marcus Meyer jedoch nicht positiv, sondern kritisch sieht. Der wissenschaftliche Leiter des Denkorts Bunker Valentin hält es für schlichtweg unzutreffend, zwischen Gewaltherrschaft und "uns allen" zu unterscheiden – ganz so, als sei die überwältigende Mehrheit der Deutschen gegen die Diktatur gewesen. Der 8. Mai sei "in allererster Linie der formale Tag der Befreiung der Opfer der NS-Herrschaft" zu verstehen.
Bislang hat es der 8. Mai in der Bundesrepublik nicht zum gesetzlichen Feiertag gebracht. Auch wenn das in jüngster Zeit vermehrt gefordert wird, unter anderem in den Wahlprogrammen der Linken und Grünen zur nahenden Bürgerschaftswahl. Anders in der DDR, wo der 8. Mai von 1950 bis 1966 als "Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus" begangen wurde. Diese Tradition lebt in Gestalt eines Gedenktages in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen fort. Seit 2020 gibt es den 8. Mai auch in Bremen und Schleswig-Holstein als Gedenktag, seit 2022 in Hamburg.
Eine Veranstaltungsserie wie zum 27. Januar – dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus an jenem Datum im Winter 1945, als Auschwitz befreit wurde – oder dem 9. November – dem Tag der Pogrome von 1938 – gibt es am 8. Mai nicht. Geplant ist lediglich eine Gedenkstunde am Mahnmal "Vernichtung durch Arbeit" vor dem Bunker Valentin. Damit wollen Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff und Bürgermeisterin Maike Schaefer an die Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnern. Gleichwohl will Meyer den Gedenktag nicht gering schätzen. "Ich finde ihn trotzdem wichtig", sagt er.